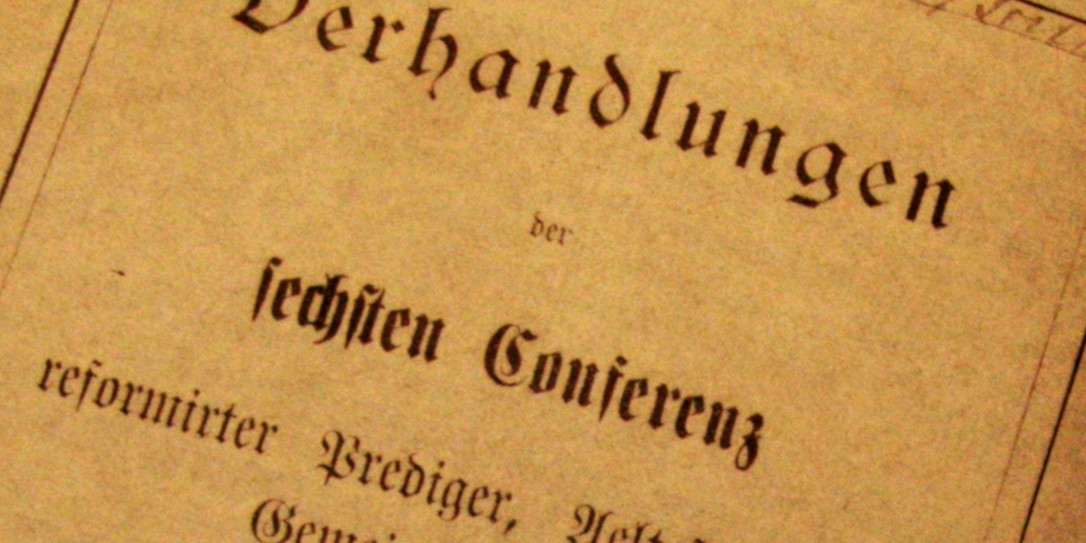Wichtige Marksteine
Reformierte im Spiegel der Zeit
Geschichte des Reformierten Bunds
Geschichte der Gemeinden
Geschichte der Regionen
Geschichte der Kirchen
Biografien A bis Z
(1528–1572)
Jeanne d´Albret (1528–1572) war die bedeutendste Frau in der Geschichte der Hugenotten im 16. Jahrhundert. Besonders in ihrem Witwenstand, in den letzten zehn Jahren ihres Lebens, baute sie eine reformierte Kirche in Béarn auf und war das politische Oberhaupt der Hugenotten im dritten Religionskrieg (1568–1570). Nach 1570 versuchte sie, die Reformierten zu schützen und ihnen einen gesicherten Platz in der Gesellschaft zu verschaffen. Sie handelte für die Hugenotten den Friedensschluss von St. Germain 1570 aus, und durch die Heirat ihres Sohnes Heinrich (später Heinrich IV. von Frankreich) mit Margarete von Valois, Schwester des Königs Karl IX. von Frankreich, strebte sie eine enge Verbindung von Hugenotten und Katholiken an.
Keine andere Frau hatte eine solche Machtposition unter den Hugenotten in Frankreich inne. Sie war respektiert und gefürchtet in Rom und Madrid, alliiert mit Elizabeth von England und befreundet mit Katharina von Medici – keine unkomplizierte Freundschaft zwischen zwei starke Frauen.
Sie sorgte dafür, dass ihre Kinder – Heinrich und Katharina – im reformierten Glauben erzogen wurden. Jahrelang kämpfte Heinrich als Anführer der Hugenotten und von einer Machtbasis in Südfrankreich aus um die französische Krone, bis er 1589 König von Frankreich wurde und schließlich 1593 zum katholischen Glauben übertrat, um das Land zu befrieden.
Jeanne d´Albret war nicht nur Mutter ihres berühmten Sohnes, sie war auch selbst eine machtvolle Frau in Frankreich, da ihre Position als Anführerin der Hugenotten ihr einen Einfluss weit über die Grenzen ihres kleinen Königreiches zusicherte.
Jugend und Ehe (1528-1555)
Jeanne d´Albret wurde am 7. November 1528 auf dem Schloss Blois von Margarete und Heinrich II. von Navarra geboren. Ihre Mutter wusste angeblich, dass sie eine Tochter gebären würde, ihr sehnlichster Wunsch war freilich nach einem Sohn. Jeanne blieb das einzige Kind aus dieser Ehe, Margarete von Navarra gebar zwar kurz danach einen Sohn, der als Kleinkind starb, und alle übrigen Hoffnungen auf Schwangerschaften zerschlugen sich.
Die kleine Prinzessin konnte von ihrem Vater das Königreich Navarra erben, weil dort das salische Gesetz, das in Frankreich weibliche Thronerben verbot, nicht gültig war. Außerdem war das vicomté Béarn selbständig. Deswegen waren die zwei Großmächte Spanien und Frankreich zutiefst an diesen Grenzregionen interessiert. Frankreich wollte seine Südgrenze verteidigen, und Spanien beide Seiten der Pyrenäen besitzen, um in Frankreich einfallen zu können. Zudem war die väterliche Familie von Albret Großgrundbesitzer in Südwestfrankreich und damit Vasall des französischen Königs. Das frühere Aquitanien hatte mehrere hundert Jahre der englischen Krone gehört und war spät von England aufgegeben worden. Im 16. Jahrhundert wurde das Gebiet meistens als Guyenne bezeichnet.
In ihren jungen Jahren wuchs Jeanne in der Normandie auf. Ihre Mutter, Margarete von Navarra, hatte die Aufgabe, die königlichen Kinder ihres Bruders, Franz I., zu erziehen. Sie gab Jeanne in die Obhut ihrer Freundin Aymée de Lafayette, Vogtin von Caen. Man behauptet, sie sei die Vorlage für die Figur Longarine in Heptameron (vgl. Nielsen). Nach meiner Auffassung sind die Erzähler/innen im Heptameron, die sogenannten devisants, eher Typen als historische Persönlichkeiten, die Figur der Longarine ist allerdings eine sehr sympathische Frau mit Humor und Pfiff. Wenn Aymée de Lafayette die Vorlage zu Longarine abgegeben haben soll, deutet alles darauf hin, dass Margarete sie sehr schätzte und meinte, ihre Tochter sei bei ihr gut aufgehoben.
Jeanne wuchs in einem landadligen Milieu auf, umgeben von Wald, Wiesen und Tieren, mit den Mitgliedern der Familie von Aymée de Lafayette als Bezugspersonen, bis sie zehn Jahre alt war. Ihre Mutter sah sie selten, aber jedes Mal, wenn sie krank war, war Margarete sofort zur Stelle. 1538 ließ Franz I. sie nach Plessis-lez-Tours bei der Loire übersiedeln, da sie jetzt ein Alter erreicht hatte, wo sie auf dem Heiratsmarkt von Interesse war. Der König konnte über seine Verwandte entscheiden und Ehen arrangieren, wie es ihm passte.
1540 war es für Jeanne so weit. Herzog Wilhelm der Reiche von Kleve-Jülich-Berg hatte 1538 das Herzogtum Geldern geerbt. Sein Erbanspruch wurde von Kaiser Karl V. angefochten und auf dem Reichstag zu Regensburg wurde dem Kaiser Geldern zugeteilt. 1539 folgte Wilhelm seinem Vater auf dem Thron nach, und um sich vor den Ansprüchen des Kaisers zu schützen, arrangierte er eine Ehe mit Heinrich VIII. von England für seine Schwester Anna, und selbst verbündete er sich mit Franz I. Als Unterpfand für dieses Bündnis sollte er Jeanne d´Albret heiraten.
Was jetzt passierte, ist absolut ungewöhnlich: Jeanne weigerte sich. Die Zwölfjährige ließ ihrem Onkel wissen, dass sie den Herzog nicht heiraten möchte, und sie ließ zwei Schreiben aufsetzen, in welchen sie erklärte, dass sie gegen ihren Willen zu dieser Ehe gezwungen worden sei. Natürlich konnte sie sich nicht auf Dauer gegen den Willen des Königs auflehnen, aber bei der Hochzeitszeremonie am 14. Juni 1541 weigerte sie sich, zum Altar zu schreiten, stattdessen musste sie getragen werden. Ihr Jawort war nicht hörbar und wegen ihres Alters wurde die Ehe nicht vollzogen, der Herzog setzte nur symbolisch ein Bein in ihr Bett. Nach der Hochzeit kehrte er zurück nach Düsseldorf, während Jeanne vorläufig in Frankreich blieb.
1543 griff Kaiser Karl Kleve-Jülich-Berg an, der Herzog wurde geschlagen und musste Geldern Karl V. überlassen. Am Frieden von Venlo im September 1543 hob er das Bündnis mit Franz I. auf und verbündete sich stattdessen mit dem Kaiser. Damit war auch die französische Ehe hinfällig geworden, 1545 wurde sie vom Papst wegen Nichtvollzug annulliert, und der Herzog vermählte sich mit einer Nichte des Kaisers.
Nach kanonischem Recht durfte bei einer Eheschließung keine Zwang im Spiel sei. Die Eheleute mussten ihr Gelübde frei abgeben. Damals konnten junge Frauen aus adligen oder königlichen Familien sich ihre Ehepartner nicht selbst aussuchen, sondern wurden als politische Garanten vermählt, und die meisten fanden sich damit ab, weil das ihr Standesbild entsprach. Jeannes Ablehnung, so wie ihre Kenntnis des kanonischen Rechts, ist erklärungsbedürftig.
Eine mögliche Erklärung ist, dass ihre Eltern für sie eine Ehe mit dem Kronprinzen Philipp von Spanien anstrebten. Königin von Spanien war natürlich prestigeträchtiger als Herzogin von Kleve zu sein, aber vor allem erhoffte sich ihr Vater damit den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. 1512 hatten die Spanier Navarra, das Baskenland, bis zu den Pyrenäen erobert und den Albrets nur das winzige Gebiet auf der französischen Seite gelassen. Seitdem überlegten sich die Könige von Navarra, wie sie zu ihrem ganzen Erbe kommen konnten, und eine Ehe zwischen dem Infanten von Spanien und der zukünftigen Königin von Navarra würde genau dies herbeiführen.
Jeanne war möglicherweise auch beeinflusst von einer Erklärung der Ständeversammlung von Béarn, die eine auswärtige Ehe für ihre Kronprinzessin ablehnte.
Sah Jeanne d´Albret ihre Zukunft gefährdet durch eine Ehe mit dem Herzog von Kleve? Oder tat sie, was ihre Eltern wünschten, statt des Königs Willen zu erfüllen? Stammten ihre Kenntnisse des kanonischen Rechts von denen? Margareta von Navarra schrieb ihrem Bruder, sie habe keine Ahnung, was in das Mädchen gefahren sei, aber stimmt das? Hat sie Jeanne mit ihrer Ablehnung der Ehe geholfen aus Liebe (Cholakian & Cholakian), oder aus Ehrgeiz? Es besteht kein Zweifel, dass königliche Kinder damals frühreif waren und in jungen Jahren schon an ihre späteren Aufgaben geführt wurden, trotzdem ist die Zähigkeit und Sturheit des Mädchens erstaunlich.
1547 starb Franz I. und als Jeanne zwanzig Jahre alt war, bot der Nachfolger, Heinrich II. von Frankreich, ihr gleich zwei Heiratskandidaten an: den Herzog Franz von Aumale (der spätere erzkatholische Herzog Franz von Guise) und Anton von Bourbon, Herzog von Vendôme. Der letztere war Erbprinz und vielleicht deshalb für Jeanne die bessere Partie, obwohl er relativ arm war. Er war hochgewachsen – was für einen Bourbon eher selten war – und charmant, wie alle Männer in seiner Familie scheint er ein unverbesserlicher Schürzenjäger gewesen zu sein. Heinrich IV. von Frankreich, der vert galant, hatte seine ausgelebte Sexualität nicht von Fremden, ebenso wenig wie sein militärisches Können und seinen Mut.
Jeanne und Anton von Bourbon heirateten 1548 und sie war überglücklich. Heinrich II. schrieb in einem Brief, dass er selten eine Braut erlebt habe, die immer nur lachte. Diese Ehe war aus Liebe geschlossen, und Anton von Bourbon nahm seine Frau mit, als er in den Krieg zog. Der Kriegsschauplatz war Flandern, und da der Herzog Güter in Nordfrankreich besaß, zog Jeanne in den ersten Jahren ihrer Ehe von Schloss zu Schloss, immer in der Hoffnung, dass sie und Anton von Bourbon sich treffen könnten.
1551 gebar sie ihren ersten Sohn und gab ihn an Aymée de Lafayette, die sie selbst erzogen hatte. Ob nun Frau de Lafayette alt oder übervorsichtig geworden war, der kleine Herzog von Beaumont starb als Kleinkind, angeblich weil er von Wärme erstickt worden sei.
Bald wurde Jeanne wieder schwanger, und während ihr ältester Sohn in Nordfrankreich geboren war, sollte das zweite Kind in Béarn zu Welt kommen. Sie unternahm die lange Reise nach Süden und kam gerade rechtzeitig in Pau an, 14 Tage bevor sie von ihrem zweiten Sohn, Heinrich, auf dem Schloss in Pau entbunden wurde. Es wurde entschieden, dass dieser Junge in Pau bleiben sollte. Der Großvater, Heinrich d´Albret, wollte wahrscheinlich mit diesem kleinen Prinzen die Erbfolge in Béarn und Navarra sichern. Die Legenden von der rauen Erziehung Heinrichs seitens des Großvaters können jedoch nicht wahr sein, allein weil das Kind die ersten Jahre von Ammen betreut wurde, und der Großvater starb, als es zwei Jahre alt war. Es scheint in Béarn Sitte gewesen zu sein, die Lippen des Täuflings mit Rotwein und Knoblauch einzureiben, eine Taufe à la Gascogne, aber die Mär, dass Heinrich barfuß unter den Hirten in den Bergen aufgewachsen sein soll, ist reine Legende. Der spätere Hauslehrer Heinrichs, Palma Cayet, schrieb, als Heinrich schon König von Frankreich war, seine Biographie, und daher stammt der Bericht vom Opa und von seiner rauen Erziehung. Dieser Kindheitsbericht ist eher Propaganda des Königs, wie er gerne gesehen werden möchte.
Tatsächlich kam Heinrich in die Obhut der Familie de Miossens, die auf dem Schloss Coarraze wohnte. Die Frau, Suzanne de Bourbon-Miossens, war eine Cousine von Jeanne. Heinrich wurde demnach genau wie seine Mutter als Landadliger erzogen, und er wuchs in einer Familie mit anderen Söhnen auf, die als Erwachsene seine Gefolgsleute werden sollten. Als seine Mutter den Thron erbte, wurde er schon als Kleinkind als Kronprinz behandelt.
Die zwei Jahre zwischen Heinrichs Geburt 1553 und ihre Thronbesteigung 1555 verbrachte Jeanne wiederum in Nordfrankreich in der Nähe ihres Gatten. In dieser Zeit gebar sie einen dritten Jungen, der jedoch nicht lange lebte. Es muss hinzugefügt werden, dass Anton von Bourbon 1554 einen außerehelichen Sohn, Karl von Bourbon, mit einer Hofdame bekam. Jeanne hatte bereits mehrere Onkel, die illegitim waren, und sie scheint den kleinen Karl in ihrer Familie aufgenommen zu haben. Er wurde später Erzbischof von Rouen.
Erst als der Vater gestorben war, zog sie als Königin nach Pau und obwohl sie die Erbin war, ließ sich ihr Mann als König huldigen, was die Ständeversammlung eigentlich gar nicht wollte, dennoch ordneten sie sich dem Willen Jeannes unter.
Königin an der Seite von Anton von Bourbon (1555–1560)
Ihr Vater hatte Jeanne ein blühendes Land hinterlassen. Er hatte Industrien nach Béarn geholt, das Steuersystem effektiv gestaltet und für den religiösen Frieden gesorgt. Große Einkünfte entstanden auch durch seine Posten als Gouverneur und Admiral der französischen Krone in Guyenne. Anton von Bourbon bekam diese Posten nach seinem verstorbenen Schwiegervater, und später hat sein Sohn, Heinrich von Navarra, sie übernommen. Jeanne und Antoine standen als die größten Grundbesitzer Südwestfrankreichs finanziell sehr gut da.
1555 find Calvin seine missionarische Tätigkeit in Frankreich an. Reformierte gab es in Südwestfrankreich zu diesem Zeitpunkt längst, weil Margareta von Navarra sie mit Predigern unterstützt hatte und Gérard Roussel, einen Reformkatholiken, als Bischof in Orthez, eingesetzt hatte. Dieser Roussel war einmal Weggefährte Calvins gewesen, und dieser warf ihm vor, nicht konsequent genug zu sein, als er die Stelle als katholischer Bischof trotz seiner reformatorischen Sympathien annahm (CStA I,1).
Als Königin hatte Jeanne bei ihrer Krönung versprechen müssen, die katholische Religion zu verteidigen. Am selben Tag, nachdem sie diesen feierlichen Eid abgelegt hatte, schrieb sie an einen Vasallen, dem vicomte von Gourdon, und erzählte ihm, sie wolle über die Förderung des reformierten Glaubens im kleinem Kreis heimlich beraten. Dieser Brief ist Teil eines Briefwechsels mit zwei vicomtes de Gourdon, Vater und Sohn, die die gesamte Regierungszeit Jeannes überdauerte. Die Briefsammlung wurde im vorigen Jahrhundert entdeckt und gibt viele neue Einsichten in die Vorhaben und die Beweggründe Jeannes. Da die entdeckten Briefe uns nur als teilweise fehlerhafte Kopien vorliegen, haben viele Forscher die Briefe als Fälschungen abgetan (Text und Diskussion bei Bryson).
Der erste Brief vom August 1555 teilt uns mit, dass Jeanne schon zu diesem Zeitpunkt reformierte Sympathien deutlich aussprach. Sie schrieb dem vicomte, dass ihre Mutter sich zwischen den zwei Religionen nicht habe entscheiden können, und dass sie selbst aus Furcht vor ihrem Vater bislang nicht gewagt habe, sich offen zum Protestantismus zu bekennen. Das Edikt von Chateaubriant von 1551 verbot eindeutig jede „Ketzerei“ und deshalb schlug sie vor, die Reformierten sollten sich heimlich auf dem Schloss Odos treffen.
Es gibt sonst keine Quellen, die belegen könnten, dass Jeanne mit dem reformierten Glauben in Berührung kam. Es gab in ganz Frankreich zu der Zeit kleine zerstreute Gemeinden, sowie Prediger und Kolporteure, die reformatorische Bücher schmuggelten. Die wiederholten Verbote des Königs konnten das nicht unterbinden, sie führten nur dazu, dass Protestanten, wie Jeanne, sich heimlich treffen mussten.
In den Jahren nach 1555 verbreitete sich der reformierte Glaube mehr und mehr im Hochadel. Auch Anton von Bourbon wurde davon ergriffen, brachte reformierte Prediger nach Béarn und als er und Jeanne 1558 mit Heinrich nach Paris zogen, nahm er an großen psalmensingenden Demonstrationen außerhalb der Stadtmauern von Paris teil. Calvin war darüber hoch erfreut, denn er setzte in seiner Missionsarbeit gerne auf hochrangige Persönlichkeiten. Jeanne dagegen verhielt sich während dieser Zeit bedeckt.
In Paris kam sie mit ihrem vierten Kind, einer Tochter namens Katharina, nieder. Das kleine Mädchen war das einzige Kind, das bei Jeanne aufwachsen durfte, obwohl sie (natürlich) Erzieherinnen und Gouvernanten hatte.
Anton von Bourbon fiel nicht nur mit protestantischen Sympathien auf, sondern wie sein Schwiegervater versuchte er, den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. Heinrich d´Albret hatte seinen Besitz gut und gewinnbringend regiert, während Anton von Bourbon seiner Frau die Regierungsgeschäfte überließ, und selbst nur versuchte, ein größeres Königsreich für sich zu gewinnen. So konnte der spanische König Philipp ihm einen Tausch, erst mit dem Herzogtum Milano und später mit Sardinien, anbieten. Damit hätte Spanien den Sprung über die Pyrenäen geschafft und Südfrankreich bedrohen können. Wir würden solches Taktieren mit dem Feind Hochverrat nennen, damals räumte man freilich Adligen große Freiheiten ein, sich einen Herren auszusuchen, aber Anton von Bourbon wurde auch von den Zeitgenossen als unzuverlässig und unverantwortlich angesehen, und nicht zuletzt war er so politisch ungeschickt, dass es an Dummheit grenzte (Sutherland 1984).
Im Sommer 1559 starb Heinrich II. von Frankreich unerwartet. Sein Sohn Franz II. folgte ihm als nur fünfzehnjähriger Knabe auf dem Thron. In dieser Situation war die traditionelle Lösung, dass der erste erwachsene Erbprinz, Anton von Bourbon, ihn unterstützen sollte, und Calvin ermahnte ihn eindringlich, dieses Amt zu übernehmen und dabei den Hugenotten zu helfen. Anton von Bourbon verspielte diese Chance und überließ die Regierungsgeschäfte der Familie von Guise, besonders dem Herzog von Guise und dem Kardinal von Lorraine, die beide die antiketzerische Politik des verstorbenen Königs weiterführen wollten. Nach dem Tod Heinrichs II. bekannten sich mehrere hochrangige Adlige offen zum Protestantismus und es gab im März 1560 sogar einen hugenottischen Komplott, den König zu entführen und von seinen „schlechten Ratgebern“ zu trennen. Anton von Bourbon und sein jüngerer Bruder, der Prinz von Condé, beide notorische Reformierte, wurden wegen diesem Angriff auf den König angeklagt. Anton von Bourbon versprach Besserung, während sein Bruder, der Prinz Ludwig von Condé zum Tode verurteilt wurde. Nur der plötzliche Tod des jungen Königs rettete ihn vor der Hinrichtung. Da der neue König, Karl IX., ein zehnjähriges Kind war, brauchte Frankreich einen Regenten, nämlich den ranghöchsten Erbprinz Anton von Bourbon. Wiederum ergriff dieser nicht die Chance. Katharina von Medici ließ sich stattdessen als Regentin einsetzen und Anton von Bourbon wurde zum Generalstatthalter ernannt. Die Hugenotten mit Calvin an der Spitze waren zutiefst enttäuscht. In diesen Jahren hatte der reformierte Glaube großen Zulauf, es wurde von mehreren Tausend Gottesdienstbesuchern überall in Frankreich berichtet, von Abendmahlgottesdiensten, die zwei Tage dauerten und von Bekehrungen am Hof und im Hochadel.
1560 verließ Jeanne Paris, um zurück nach Pau zu fahren. Theodorus Beza, der engste Mitarbeiter Calvins, besuchte sie dort, und es entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit, die bis Jeannes Tod dauerte. Beza versorgte sie mit Predigern und Beratern für ihr Land. Im Dezember 1560 unternahm Jeanne den entscheidenden Schritt und bekehrte sich öffentlich zum reformierten Glauben. Während ihr Gatte nicht in der Lage war, sich an die Spitze der Hugenotten zu setzen, wurde sie jetzt die leitende Hugenottin in Frankreich.
Reformierte Königin (1560–1568)
Jeanne d´Albret war zweifelsohne eine tief religiöse Frau. Lange Zeit hatte sie äußerste Diskretion walten lassen, zwar mit ihrem Gatten reformierte Prediger gehört, aber sich niemals offen zum reformierten Glauben bekannt. Erst nachdem Anton von Bourbon sich mit dem Posten als lieutenant générale abgefunden hatte, kam sie aus der Deckung.
Es war eine Zeit, wo alle große Hoffnungen bzw. Ängste für den Protestantismus in Frankreich hegten. Drei wichtige Katholiken – der Herzog von Guise, der Konstabel von Montmorency und der Marschall St. André – schlossen sich zusammen, um Frankreich gegen die Reformierten zu schützen. Sie planten den Sturz von Anton von Bourbon und einen Angriff auf Genf mit der Hilfe des Herzogs von Savoyen, zu dessen Besitz Genf bis 1534 gehört hatte. Dieses Triumvirat war der erste Vorbote der katholischen Liga, die später Heinrich IV. hartnäckig bekämpfte (Sutherland 1973).
1560 war noch zu erwarten, dass der Protestantismus nach Frankreich gekommen war, um zu bleiben. Jeanne war sich sehr bewusst, welche Gefahren ihr von Spanien, vom Papst und von der mächtigen Familie von Guise drohten. Sie hatte noch die Hoffnung, dass der junge König Karl IX., Katharina von Medici und ihr Kanzler, der tolerante Michel de l´Hôpital, die Reformierten unterstützen würden, zumal die Königinmutter sich selbst von denen von Guise bedrängt fühlte.
Diese letzte Hoffnung erwies sich als trügerisch, aber niemals wich Jeanne später vom einmal eingeschlagenen Kurs ab. Sie konnte weder geldwerte Vorteile noch politisches Kapital aus ihren Glauben schlagen, dafür hielt sie konsequent an ihrer Überzeugung fest.
In Béarn machte sie erste vorsichtige Schritte, um das Land zu reformieren. Es gab schon Reformierte dort, und Prediger hatten angefangen, den neuen Glauben zu verbreiten, Jeanne aber träumte von einem reformierten Land, und fing langsam und vorsichtig an, diesen Traum zu verwirklichen.
Der erste Schritt war, den reformierten Glauben dem Katholizismus rechtlich gleich zu stellen. Die Kirchen wurden für beide Religionen geöffnet (das sogenannte simultaneum) und aus den Kirchen in Lescar und Pau wurden Bilder und Statuen entfernt, allerdings nicht in Form eines Bildersturms, sondern von den Behörden. Jeanne beschlagnahmte das kirchliche Vermögen nicht für sich selbst, sondern investierte es in Sozialfürsorge und Bildung.
Es ist klar, dass sie den reformierten Glauben einführen wollte, aber zu keinem Zeitpunkt vefolgte sie Andersgläubige, geschweige denn verbrannte sie. Immer setzte sie auf Überredung.
Im August 1561 begab sie sich wieder zum Hof. Überall wurde sie stürmisch von Hugenotten begrüßt, als ob sie „der Messias sei“, bemerkte verärgert der spanische Gesandte. Katharina von Medici hatte zu einem Religionsgespräch eingeladen. Dieses Gespräch fand in Poissy außerhalb Paris statt. Seitens der Krone war gewiss an eine Versöhnung oder gar einen Ausgleich zwischen den Religionen gedacht, die reformierten Teilnehmer mit Beza an der Spitze mochten jedoch keine Kompromisse eingehen. Beza wurde unterstützt von Calvin in Genf, der selbst zu krank war, um mitzukommen. Calvin war mit den Auftritten und Reden Bezas zufrieden, während z.B. der Admiral Coligny Beza als reichlich provokant wahrnahm.
Im Herbst 1562 blieb Jeanne mit ihren Kindern beim Hofe. Katharina von Medici suchte auch nach den Religionsgesprächen eine Übereinkunft mit den Protestanten, was in dem Edikt vom 17. Januar 1562 – auch Edikt von St. Germain genannt – gipfelte. Dieses Edikt, an dem der Kanzler Michel de l´Hôpital und Beza beteiligt waren, erlaubte es den Hugenotten, außerhalb der Städte Gottesdienste zu halten. Es war das günstigste Edikt, das sie jemals erlangen sollten, das Edikt von Nantes 1598 war ihm sehr ähnlich, aber nicht ganz so großzügig. Der Unterschied war, dass Heinrich IV. dafür sorgte, dass das Edikt von Nantes durchgeführt wurde, während alle frühere Edikte, so wohlgemeint sie auf dem Papier auch waren, von katholischen Behörden unterlaufen wurden, und der König zu schwach war, um für ihre Durchführung zu sorgen.
Im März 1562 massakrierte der Herzog von Guise eine reformierte Gemeinde, die innerhalb des Städtchens Wassy Gottesdienst feierte. Damit war die Versöhnungspolitik Katharinas von Medici gescheitert. Die Hugenotten unter dem Prinzen von Condé griffen zu den Waffen und Anton von Bourbon bat Jeanne den Hof zu verlassen. Er behielt seinen Sohn Heinrich bei sich, entließ aber dessen hugenottischen Hauslehrer. Jeanne beschwor ihren Sohn, nicht zur Messe zu gehen, und der junge Prinz hielt sich wohl auch ein paar Wochen daran, musste sich aber schließlich fügen. Nach ihrem Fortgang vom Hofe trat Jeanne eine monatelange abenteuerliche Reise durch Frankreich an, so gefährlich, dass die ersten Briefen von der Hand Heinrichs seine Ängste um seine Mutter bezeugen. Ihre kleine Tochter Katharina durfte sie behalten.
Im ersten Religionskrieg führte Anton von Bourbon die königlichen katholischen Truppen gegen die Hugenotten. Bei der Belagerung von Rouen wurde er verwundet und starb am 17. November. Der junge Heinrich blieb am Hofe in der Obhut Katharinas von Medici, die allerdings Jeanne gestattete, ihm wieder reformierte Hauslehrer zu geben. Sie sollte ihn erst 1564 wiedersehen.
Die Kirche in Béarn und Navarra
Ihre große Aufgabe sah Jeanne darin, die Reformation in Béarn durchzuführen.
Calvin stellte ihr Jean Raymond Merlin zur Seite, den früheren Professor für Hebräisch in Lausanne, wo er Kollege von Beza, dem Professor für Griechisch, und von Pierre Viret, dem Rektor der Akademie, gewesen war. Pierre Viret arbeitete nach seiner Zeit in Lausanne und Genf vor allem in Frankreich, besonders in den Kirchen von Lyons und Nîmes. Später sollte er für Jeanne d´Albret ihre Akademie in Orthez aufbauen. Merlin war übrigens mit einer Tochter von Marie Dentière verheiratet, derjenigen, die vor Jahren Jeanne eine selbstgeschriebene hebräische Grammatik zugesandt hatte (vgl. Graesslé13f.; Nielsen).
Merlin ging voll Eifer an die Aufgabe, eine reformierte Kirche in Béarn aufzubauen. Es gab viele Reformierte in Südfrankreich, aber meistens unter städtischen Eliten und Handwerkern. Die Reformierten waren meistens des Lesens fähig, vor allem des Lesen französischer Texte. In Südwestfrankreich sprach die Bevölkerung die langue d´oc, die alte oczitanische Sprache, in irgendeiner Form. Die Gascogne hatte ihre Sprache, in der ein Neues Testament und fünfzig Psalmen übersetzt wurden, und Béarn hatte béarnais sogar als Amtssprache. Hinzu kam, dass die Bevölkerung in Navarra Baskisch sprach. Wenn Merlin das ganze Land reformieren sollte, musste er diese Sprachbarrieren überwinden, denn die Landbevölkerung musste erreicht und für die Reformation gewonnen werden.
Jeanne d´Albret beauftragte eine Übersetzung des Neuen Testaments ins Baskische, und eine Übertragung der Psalmen, der Zehn Gebote, der Liturgie und des Katechismus Calvins in die Sprache Béarns. Der Anwalt, später Pastor, Arnaud de la Salette, stellte 1571 diese Übersetzung fertig, und obwohl sie erst 1583 gedruckt wurde, darf man annehmen, dass in der Zwischenzeit Manuskriptkopien verwendet wurden. Pastoren, die die béarnesische oder die baskische Sprache beherrschten, wurde händeringend gesucht, und von den Anderen wurde ausdrücklich verlangt, dass sie es lernen sollten. Katecheten, die vermutlich Landeskinder waren, wurden in die Gemeinden geschickt.
Allmählich verbot Jeanne katholische Riten und Gebräuche, zuerst die Fronleichnamsprozessionen, danach Maibäume und Jahrmärkte. Dann wurde die Messe abgeschafft. Der Dom von Lescar und die Kirche St. Martin in Pau wurden leergeräumt, und die dort befindlichen Schätze verkauft.
Für Merlin konnte dies nicht schnell genug gehen. In seinen Briefen an Calvin klagte er seine Not: die Bevölkerung sei stur – diese Holzköpfe! - und die Königin zu langsam und vorsichtig (CO 20, Nr. 3988 & Nr. 4061). Merlin hatte übrigens auch früher in Montargis Probleme mit Renée de France gehabt, Herzogin von Ferrara, die in ihrem Gebiet so vorsichtig war wie Jeanne in Béarn (vgl. Lambin, 2). Jeanne bekam Klagen auf der jährlichen Ständeversammlung, wo die Katholiken über den Verlust alter Freiheiten und Rechte klagten. In den sechziger Jahren musste sie mehrmals Aufstände niederschlagen.
Der Nachfolger für Merlin war Pierre Viret, der enge Freund Calvins. Er war Pastor und Rektor für die Akademie in Lausanne – mit Beza und Merlin als Kollegen – gewesen. Wegen eines Streits mit dem Stadtrat in Bern, übersiedelten 1559 alle Professoren nach Genf, um dort in der neu errichteten Akademie zu unterrichten. Von Genf begab Viret sich nach Frankreich, wo er in Lyon als Pastor arbeitete, danach leitete er die Nationalsynode in Nîmes und schließlich folgte er dem Ruf nach Béarn. Seine wesentlichste Aufgabe war es, die Akademie in Orthez aufzubauen. Die Fächer Theologie, Hebräisch, Griechisch, Philosophie und Mathematik wurden dort unterrichtet, während es keine Anzeigen für Professuren in Jura und Medizin gibt.
Vor ihrer akademischen Laufbahn absolvierten die Jungen eine fünfjährigen Ausbildung in einer Lateinschule (collège), während die Grundschule sowohl Jungen wie Mädchen unterrichtete, die Mädchen allerdings getrennt mit weiblichen Lehrkräften. Damit wurde das kleine Béarn das erste Land Europas, welches kostenlosen Unterricht für Mädchen zusicherte, und zwar mit der interessanten Begründung, dass sie so im Stande waren, ihr Brot zu verdienen und sich der Gesellschaft nützlich zu machen („Pareil rolle sera aussy faict des filles qui sont en bas aage et qui n´ont nul moyen de vivre et de s´entretenir, par toutes les églises, afin que de mesmes deniers et en écolle séparée elles soient enseignées, nourries et tenues par des femmes sages et pudiques, par leur industrie pouvoir aprés se nourrir et entretenir et servir au public“. Art. 32 der Verfassung der Akademie von 1566, zitiert nach Desplat 2004). Desplat unterstreicht die säkulare Ausrichtung der Ausbildung. Allgemein wird behauptet, der Zweck des Unterrichts in protestantischen Ländern sei, die Bevölkerung des Lesens der Bibel und des Katechismus zu befähigen. Hier werden nur die Vorteile eines Schulunterrichts für die Gesellschaft betont.
Die Akademie wurde 1566 geöffnet. Die ersten protestantischen Akademiegründungen in Frankreich fanden in Nîmes (1562) und Montpellier statt. Vorrangiges Ziel war es, die Kirchen mit Pastoren zu versorgen, da die Akademie in Genf die steigende Nachfrage der Gemeinden kaum nachkommen konnte. Da Papst Pius V. die katholischen Universitäten angewiesen hatte, Protestanten die Abschlüsse zu verweigern (Maag 2002, 140), brauchten junge Hugenotten ihre eigenen Universitäten, die dann auch gegründet wurden, vor allem in Leiden und Heidelberg, aber auch in Frankreich und benachbarten Gebieten wie Béarn, Orange und Sedan, die alle zu diesem Zeitpunkt unabhängig waren.
Jeanne hatte sehr gute Gründe, langsam und überlegt vorzugehen. Der Kardinal von Armagnac ließ sie wissen, dass sie die Bevölkerung Béarns in Ruhe lassen sollte, ihre Untertanen wollten ihren Katholizismus nicht aufgeben. Jeanne antwortete, dass sie in Béarn nur Gott über sich habe, dort könne sie ihrem Gewissen folgen, und in ihrem Land werde niemand wegen seines Glaubens verfolgt. Das letzte war ihr ein Anliegen, denn 1571 schrieb sie an ihren Statthalter, den Baron d´Arros, dass in ihrem Land niemand zum Glauben je gezwungen worden war und es auch nicht werden sollte („...intention n´a point esté et n´est encores qu´ilz soyent contraints par force et violence de se reanger à ladite Religion“, d´Aas 2002, 452).
Als sie sich bei der Einführung der Reformation in ihren Ländern unnachgiebig zeigte, zitierte der Papst sie nach Rom zwecks eines Ketzerprozesses. Da sie dieser Einladung nicht folgte, exkommunizierte er sie. Der Bann war eine ernste Bedrohung, da jeder katholische Herrscher jetzt das Recht hatte, ihre Länder an sich zu reißen und sie abzusetzen, eine Chance, die Philipp II. von Spanien sich nicht entgehen lassen würde. Katharina von Medici verteidigte deshalb Jeanne, weil sie keine spanische Präsenz auf der französischen Seite der Pyrenäen dulden wollte. Außerdem war sie eine Verfechterin der gallikanischen Freiheit der französischen Kirche und meinte deshalb, der Papst solle sich nicht in die Angelegenheiten der Kirche einmischen.
Königin der Hugenotten
Nach dem ersten Religionskrieg (1562-63) ließ Katharina von Medici den jungen Karl IX. mündig erklären und führte ihn mit dem Hof auf eine große Frankreichreise, die mehrere Jahre dauerte. Der Zweck dieser Reise war es, den König dem Volk zu zeigen, und damit die Loyalität der Bevölkerung zu erhalten. Jeanne wurde als Vasallin einberufen und stieß Ende Mai 1564 zum Zug in Macon.
Ihr Sohn Heinrich nahm auch Teil an diese Reise und seinetwegen stritten die zwei Königinnen sich, weil Jeanne ihn bei ihren protestantischen Gottesdiensten dabei haben wollte, und Katharina wünschte, dass er mit der königlichen Familie zur Messe gehe. Schließlich sandte Karl IX. Jeanne zu ihrem Besitz in Vendôme, während Heinrich als Gouverneur von Guyenne den Zug begleitete und in den Städten für den feierlichen Empfang des Königs sorgte.
Jeanne durfte nicht mit nach Bayonne, wo Katharina ihrer Tochter Elizabeth, Königin von Spanien, begegnen wollte. Philipp II. sandte als seinen Gesandten den Herzog von Alba, der auf dem Weg in die Niederlande war. Die Hugenotten waren später überzeugt, dass Alba und die Königinmutter in Bayonne ihre Ausrottung geplant hatten. Sicher ist, dass Alba in den Niederlanden mit aller Härte gegen die Protestanten vorging, und es ist durchaus möglich, dass er versuchte, Katharina auf seinen mörderischen Kurs einzustimmen. Schon 1568 – also vor der Bartholomäusnacht! – schrieb Jeanne, dass die Waffen, die gegen die Hugenotten verwendet werden sollten, in Bayonne geschmiedet worden seien (Ample déclaration).
Jeanne und Heinrich trafen sich später in Paris. 1566 ersuchte sie erneut um Erlaubnis, mit ihren beiden Kindern nach Béarn zu fahren, was ausgeschlagen wurde. Sie erhielt aber Erlaubnis, ihren Sohn in seinen französischen Ländereien herumzuführen, und Anfang 1567 reiste sie dann mit ihm nach Vendôme, und von dort setzte sie sich unerlaubt ab nach Béarn. Damit machte sie laut des Biographen Heinrichs, Pierre Babelon, aus einem französischen Prinzen einen Ausländer, und vor allem einen Hugenotten.
Von 1567 an arbeitete Jeanne für die Zukunft ihres Sohnes. Ihre Lebensaufgabe, schrieb sie selbst, sei: Gott, Königtum und ihr Blut. Mit Gott war die reformierte Religion, die wahre Kirche Gottes, gemeint. Mit dem König ihr Status als Vasallin und – trotz Béarn – als Französin, und mit dem „Blut“, die Familie, zuallererst ihr Sohn Heinrich. Er sollte von jetzt an kein Höfling mehr sein, sondern die Aufgaben eines Regenten lernen. Als ein Aufstand in Navarra niedergeschlagen worden war, wurde er dorthin geschickt, um die Basken zu befrieden. Als 14jähriger hielt er für seine Untertanen eine Rede, in welcher er ihr Fehlverhalten geißelte, ihnen die Gunst der Königin zusicherte, falls sie sich verbessern würden, und seinen berühmten Charme mit seinem Autoritätsanspruch verband.
Im Herbst 1567 versuchten die Hugenotten, die sich von der Aufrüstung des Königs bedroht fühlten, Karl IX. in ihre Gewalt zu bringen. Die Entführung missglückte, und die königliche Familie suchte, beschützt von den schweizerischen Söldnern, die die Ängste der Hugenotten verursacht hatten, Zuflucht in Paris. Die Hugenotten belagerten die Stadt. Im November wurden sie vor den Toren von St. Denis geschlagen und mussten sich in die Provinz zurückziehen, wo sie den Kampf bis zum Friedenschluss von Longjumeau im März 1568 fortsetzen.
Der Friedensvertrag war an sich nicht ungünstig für die Hugenotten, nur haperte es wie immer mit der Umsetzung. Katholische Behörden waren über die für die Hugenotten günstigen Bedingungen empört und setzten sie nicht um. Der Protestant La Noue schrieb in seinen Erinnerungen, dass der Krieg zwar viel Unheil bringe, aber dieser elende kleine Friedensvertrag sei viel schlimmer für die Reformierten, die in ihren Häuser umgebracht wurden, ohne dass sie sich zu wehren wagten („ …une guerre est misérable et qu´elle apporte avec soy beaucoup des maux…cette méchante petite paix est beaucoup pire pour ceux de la Réligion, qu´on assassinoit en leur maisons, et ne s´osoyent encores défendre“, d´Aas 2002, 382) Im Laufe des Sommers 1568 versuchten die Gruppierungen noch einmal miteinander zu reden, Karl IX. sandte einen Botschafter nach Béarn, und Jeanne verfasste ein Sendschreiben an den König mit dem Antrag, den Frieden in Guyenne wiederherzustellen.
In der Zwischenzeit fühlten sich der Prinz von Condé und der Admiral Coligny auf ihre Schlösser in Bourgogne zunehmend bedroht. Der Herzog von Alba wollte in den Niederlanden mit Feuer und Schwert den Protestantismus auszurotten, und Flüchtlinge berichteten ihnen von seinem Terror. Am 23. August 1568 flüchteten sie mit ihren Familien und Angehörigen über die Loire nach La Rochelle. Die Überquerung der Loire erinnerte fast an den biblischen Durchzug durchs Schilfmeer: so viele Hugenotten hatten sich angeschlossen, dass der Zug fast wie eine Völkerwanderung aussah, und die Loire hatte in der Augusthitze einen so niedrigen Wasserstand, dass Sandbanken in der Mitte auftauchten. Dementsprechend sangen alle Psalm 114 vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, als sie hinüber waren. Die Parallele wurde noch einmal deutlich, als die königlichen Truppen, die sie verfolgten, wegen plötzlich einsetzenden Hochwassers den Fluss nicht überqueren konnten.
In dieser Situation war Jeanne zutiefst gespalten. Bislang hatte sie die Kriege moralisch unterstützt, aber nicht selbst teilgenommen. Falls es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen sollte, konnte sie immer mit ihren Kindern in der uneinnehmbaren Festung Navarrenx Zuflucht suchen. Sie hatte jedoch ihren Sohn, der als zukünftiger Führer der Hugenotten das Kriegshandwerk lernen sollte, und so musste sie wählen, ob sie in Béarn unter ihrem Volk bleiben oder sich den Hugenotten anschließen sollte: „ich hatte den Krieg im Bauch“ schrieb sie danach („J´eu la guerre en mes entrailles“, Ample declaration). Sie setzte den Baron d´Arros als Statthalter ein, und Anfang September begab sie sich in Eilmarsch nach La Rochelle (Cocula 2004). Dort konnte sie ihren Sohn dem Prinzen von Condé überantworten. Sie schrieb unterwegs eine Reihe Briefe an Karl IX., an Katharina von Medici, an ihren Schwager, den Kardinal von Bourbon und an die Königin Elizabeth von England, um ihren Entschluss zu begründen. Angekommen in La Rochelle schrieb sie eine Erklärung („Ample declaration“) um der Öffentlichkeit zu erklären, warum sie sich der hugenottischen Armee zugesellte.
Die Hugenotten unter ihren Anführer aus der königlichen Familie wollten nicht als Aufrührer dastehen. Sie behaupteten, die erzkatholische Partei sei schuld daran, dass königliche Befehle nicht vollzogen wurden. Die Katholiken mit ihren Verbindungen nach Spanien und Rom seien Landesverräter. Die Politik des Kardinals von Lorraine verdient laut Sutherland (1974) keinen anderer Namen. Wenn Jeanne vom Frieden sprach, meinte sie eine Duldung der Hugenotten in Frankreich. Die Forderungen der Hugenotten waren immer dieselbe: Erlaubnis, Gottesdienste zu feiern, Gerichte mit zur Hälfte hugenottischen Richtern, sichere Zufluchtsstädte – deren Anzahl schwankte in den Verhandlungen – und Zugang zu Ausbildung und Beamtenstellen gleichrangig mit den Katholiken. Die Provinz Languedoc unter dem moderat katholischen Gouverneur Montmorency-Damville war ein friedlicher Ort in den Religionskriegen, weil Damville den Hugenotten solche Rechte einräumte, und die katholische Bevölkerung sich damit abfand.
Im März 1569 fand eine Schlacht bei Jarnac statt. Der Prinz von Condé kämpfte mit, wurde verwundet und nach der Schlacht ermordet. Es gelang Admiral Coligny, die hugenottischen Truppen zusammenzuhalten, aber der Verlust des Prinzen war ein herber Schlag. Heinrich von Navarra war jetzt der ranghöchste Prinz, und zusammen mit seinem Vetter, dem gleichaltrigen Heinrich von Condé, wurde er jetzt Oberbefehlshaber über die Armee der Prinzen. In Wirklichkeit lag die Verantwortung für die Kriegsführung bei dem erfahrenen Admiral, und die beiden Prinzen wurden seine Pagen genannt.
Jeanne blieb in La Rochelle, während Coligny mit den Prinzen im Krieg war, und sie konnte, unterstützt von einem Rat adliger Hugenotten, die „Regierungsgeschäfte“ regeln. Sie schrieb an England und nach Deutschland. Sie unterzeichnete Erlässe, versuchte Geld für das Heer aufzutreiben, pfändete ihren schönsten Schmuck für einen Kriegsdarlehen an Elizabeth von England und ließ ein Kriegsschiff namens „Die Hugenottin“ bauen.
So wie sie immer behauptete, nicht gegen den König, sondern gegen seine schlechten Ratgeber zu kämpfen, so behauptete Karl IX., dass sie in La Rochelle von den Hugenotten gefangen gehalten wurde, und er ließ den Baron Terride mit einer „Befreiungsarmee“ in Béarn einfallen. In kürzester Zeit waren ganz Béarn und Navarra erobert und zum Katholizismus zurückgeführt. Nur der Baron d`Arros hielt im Navarrenx stand. Um ihre Länder zurückzuerobern, sandte Jeanne den Graf von Montgommery mit einer „Hilfsarmee“ nach Navarrenx. In noch kürzerer Zeit als Terride gebraucht hatte, verjagte er ihn aus Béarn. Die Befreiung von Terride wurde in Pau mit einem Festgottesdienst gefeiert, wobei Pierre Viret über Psalm 124, 7: „Unsere Seele ist aus dem Netz des Vogelfängers entkommen“ predigte.
Vom Winter 1569 bis zum Frühjahr 1570 führte Coligny sein Heer mit den Prinzen Heinrich von Navarra und Heinrich von Condé durch ganz Südfrankreich und von Provence nach Norden, bis er Paris bedrohte. Der König hatte kein Geld mehr, um Krieg zu führen, und musste notgedrungen Friedensverhandlungen einleiten. Im August 1570 wurde dann der Frieden von St. Germain geschlossen. Wiederum war Jeanne d´Albret diejenige, die auf Augenhöhe mit dem König verhandeln konnte. Der Vertragstext erklärt immer wieder, dass der König die Bedingungen seiner Tante erfüllen wollte (Sutherland 1980, Potter 1997).
Jeanne blieb vorläufig in La Rochelle. Im April 1571 fand dort die Nationalsynode der reformierten Kirchen Frankreichs statt. Theodor Beza kam aus Genf angereist, um die Synode zu leiten. Pierre Viret wollte teilnehmen, starb aber vorher, vermutlich hatte seine Gesundheit in der Gefangenschaft unter Baron Terride gelitten. Auf der Synode wurde das französische Glaubensbekenntnis von 1559 neu verhandelt und die endgültige Fassung als „Bekenntnis von La Rochelle“ beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Kirchenordnung für Béarn beschlossen, und die Synode diskutierte Fragen, die Jeanne d´Albret gestellt hatte. Als Ersatz für Pierre Viret bekam sie Nicolas des Gallars zur Seite gestellt. Er war Calvins Sekretär gewesen, danach hatte er die „Strangers´ Church“, die Kirche für Ausländer in London, als Nachfolger für Johannes à Lasco geleitet und dann an Bezas Seite im Colloquium von Poissy 1561 gestanden. Er war Pastor in Orléans gewesen und wurde jetzt Seelsorger für Jeanne d´Albret und ihr theologischer Ratgeber für die Kirche in ihrem Land.
Er war eine gute Wahl, denn während Beza sehr an dem Konzept von Genf hing und ein presbyteriales Kirchenverständnis (Kingdon 1967) hatte, war des Gallars in England gewesen, als Königin Elizabeth nach dem Tod ihrer katholischen Schwester die anglikanische Kirche einführte. Außerdem behauptet Bernard Roussel (2004), dass er das Buch Martin Bucers „De regno Christi“ von 1550 mitbrachte. Dieses Buch ist dem englischen König Edward VI. gewidmet und beschreibt, wie ein König eine reformierte Kirche leiten kann. Damit hatte des Gallars ein Konzept für eine von einer Fürstin geleitete Kirche, die dann in den Jahren als Heinrich und Katharina von Navarra das Erbe der Mutter verwalteten, Bestand hatte.
Während Jeanne in La Rochelle noch weilte, ereilte sie ein Angebot von Katharina von Medici, ob ihren Sohn Heinrich die Tochter Katharinas heiraten mochte. Hugenotten und Katholiken würden sich versöhnen und die Häuser Valois und Bourbon sich nahekommen. Dieses Angebot war zu verlockend, um es auszuschlagen, aber Jeanne traute Katharina nicht so recht, jedenfalls wollte sie nicht gleich nach Paris ziehen, um über die Ehe zu verhandeln.
Stattdessen fuhr sie nach Pau zurück, führte die neu beschlossene Kirchenordnung ein und kümmerte sich um ihre Länder. Die Tuberkulose machte sich bemerkbar und sie wollte zur Kur in die Bergen fahren. Währenddessen zogen sich die Eheverhandlungen hin, bis Jeanne endlich im Frühjahr 1572 nach Paris zog. In den Briefen an ihren Sohn hört man von den Verhandlungen, von ihrer Missbilligung des höfischen Lebens und von ihrem Ärger mit Katharina. Jeanne wollte so viele Rechte wie möglich für ihren Sohn und die Hugenotten aushandeln. Am Ende musste sie es aufgeben, Margareta von Valois, Margot genannt, zum reformierten Glauben zu bekehren. Dafür hoffte sie aber, dass das Brautpaar nach Béarn ziehen würde. Eine königliche Mischehe war etwas ganz Neues und musste in Detail besprochen und geplant werden. Jeanne handelte das Meistmögliche für ihren Sohn aus und im April 1572 wurde eine Einigung erzielt. Heinrich sollte allerdings noch eine Weile in Béarn bleiben und Jeanne bereitete in Paris die Hochzeit vor.
Die zähen Verhandlungen im Frühjahr hatten viel Kraft gekostet, Jeanne hielt sich aber tapfer. Im Juni brach sie zusammen und starb am 9. Juni an der Tuberkulose, die sie seit Jahren geplagt hatte. Später entstanden Gerüchte, sie sei von Katharina von Medici vergiftet worden. Diese sollte ihr ein Paar Handschuhe, die von ihrem privaten Giftmischer präpariert worden seien, geschenkt haben. Da Katharina nach den Massakern von St. Bartholomäus, die in der Periode von August bis November 1572 stattfanden, von den Hugenotten als der Inbegriff des Bösen dargestellt wurde, gehört der Giftmord an Jeanne d´Albret zu den Verleumdungen.
Heinrich traf erst etwas später in Paris ein. Im Testament Jeannes hatte sie sich gewünscht, in Béarn bei ihrem Vater beerdigt zu werden. Ihr Sohn setzte sich über ihren letzten Willen hinweg: sie wurde nach Vendôme geführt und neben ihrem Mann, Anton von Bourbon, bestattet.
Trotz ihre Fähigkeiten wurde sie eine Fußnote in der Geschichte Frankreichs: ihr Sohn wurde zwar als Heinrich IV. König von Frankreich, aber er wurde katholisch und aus den Hugenotten wurde, dank des Ediktes von Nantes 1598, eine geduldete Minderheit. Die Kirche, die Jeanne in Béarn aufgebaut hatte, wurde unter ihrem Enkelsohn, Ludwig XIII., verboten. 1685 wurde dann das Edikt von Nantes aufgehoben, und die Reformierten wurden grausam verfolgt. Viele flüchteten, viele konvertierten und viele wurden umgebracht. Die großen Hoffnungen, die die Hugenotten um Jahr 1560, als Jeanne konvertierte, hegten, erwiesen sich als trügerisch.
Wenn auch letztlich nicht erfolgreich, war sie dennoch bewundernswert. Mit dem Admiral Coligny zusammen hatte sie den Frieden von St. Germain errungen, dann eine Landeskirche aufgebaut und ihre Kinder gefördert. Sie war die reformierte Präsenz in der königlichen Familie und in ihren letzten Jahren wurde sie die Königin der Hugenotten.
Stammtafeln der Familie von Valois und der Familie von Bourbon (PDF)
Literatur
Quellen:
Albret, Jeanne d´: Lettres suivies d´une ample Déclaration, ed. Bernard Berdou d´Aas, Biarritz 2007.
Bordenave, Nicolas de: Histoire du Béarn et de la Navarre, Paris 1873.
Bucer, Martin: De regno Christi: libri duo, 1550, ed. François Wendel, in: Robert Stupperich, Hrsg. Ser. 2, Opera latina Bd. 15,1, Gütersloh 1955. In: Studies in Medieval and Reformation Thought, Leiden 1982. „Du royaume de Jesus Christ“, édition critique de la traduction française de 1558/texte établi par François Wendel, Bd.15,2, Gütersloh 1954.
Calvin, Johannes: Calvini opera quae supersunt omnia (= CO), hrsg.v.W.Baum, E.Kunitz, E.Reuss, 59 Bde, Braunschweig/Berlin 1863-1900.
Calvin-Studienausgabe (= CStA), hrsg.v. E.Busch u.a., Neukirchen-Vluyn ab 1994.
Coudy, Julien, ed.: Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten, Darmstadt 1965
Potter, David, ed.: The French Wars of religion, Selected Documents, London & New York 1997.
Ruble, Alphonse de: Le mariage de Jeanne d´Albret, Paris 1877.
Ruble, Alphonse de: Antoine de Bourbon et Jeanne d´Albret, Paris 1881, 1882, 1885 & 1886, 4 Bde.
Ruble, Alphonse de: Jeanne d´Albret et la guerre civile, Paris 1897.
Ruble, Alphonse de: Mémoires et poésies de Jeanne d´Albret, Paris 1893, Slatkine Reprints Genf 1970 (online auf Französisch: https://archive.org/details/mmoiresetposies00rublgoog).
Stegman, A.: Les édits des guerres de religion, Paris 1979.
Sekundärliteratur:
Aas, Bernard Berdou d´: Jeanne III d´Albret, Chronique 1528-1572, Anglet 2002.
Actes du colloque “Arnaud de Salette et son temps – Le Béarn sous Jeanne d´Albret”, Orthez 1984 (war mir leider nicht zugänglich).
Actes du colloque “L ´Amiral de Coligny et son Temps”, Paris 1974.
Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Babelon, Pierre: Henri IV, Paris 1982.
Benedict, Philip, ed.: Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585, Amsterdam 1999.
Benedict, Philip: “Confessionalization in France? Critical reflections and new evidence”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Bryson, David: Queen Jeanne and the Promised Land, Dynasty, Homeland, Religion and Violence in Sixteenth Century France, Leiden 1999.
Buisseret, David: Henry IV, London 1984.
Cazaux, Yves: Jeanne d´Albret, Paris 1973.
Cholakian, Patricia F. & Cholakian, Rouben C.: Marguerite of Navarre, Mother of the Renaissance, New York 2006.
Cocula, Anne-Marie: ”Été 1568. Jeanne d´Albret et ses deux enfants sur le chemin de La Rochelle”, Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Desplat, Christian: “Jeanne d´Albret, un modèle d´éducation maternelle?”, in: Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Eurich, Amanda: “Le pays de Canaan”: L´évolution du pastorat béarnais sous Jeanne d´Albret”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Graeslé, Isabelle: Vie et légendes de Marie Dentière, Bulletin du centre protestant d´études, Genéve 2003.
Greengrass, Mark: “The Calvinist experiment in Béarn”, in: A. Pettegree, A. Duke & G. Lewis: Calvinism in Europe 1540 - 1620, Cambridge 1994.
Kingdon, Robert M.: Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572, Genève 1967.
Knecht, R.J.: Catherine de´ Medicis, London 1998.
Kuperty-Tsur, Nadine: “Jeanne d´Albret ou la persuasion par la passion”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Lambin, Rosine: Calvin und die adelige Frauen im französischen Protestantismus, http://www.reformiert-info.de/2304-0-0-20.html
Maag, Karin: “The Huguenot academies: preparing for an uncertain future”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Martin-Ulrich, Claudie: “Récit de vie, récit de mort: Le Brief discours sur la mort de la royne de Navarre, Jeanne d´Albret” in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Mentzer, Raymond A. & Spicer, Andrew, eds.: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Nielsen, Merete: Theologie als Erzählung – erzählte Theologie, Das Heptameron von Margarete von Navarra, http://www.reformiert-info.de/side.php?news_id=5444&part_id=0&navi=4
Nielsen, Merete: Marie Dentière,
Bekennen in der Friedensfrage
Eine Erinnerung an die Reformierte Friedenserklärung 1982

Den vorliegenden Vortrag hielt Rolf Wischnath im Oktober 2015 vor Studierenden in Hannover und in Hildesheim. Rolf Wischnath lehrte als Honorarprofessor Systematische Theologie an der Universität Bielefeld. Von 1995 bis 2004 war er Generalsuperintendent in Cottbus.
1982 wurde unter seiner Federführung die Erklärung "Das Bekenntis zu Jesus Christus und die Friedensverantwortung der Kirche" verfasst und vom Moderamen des Reformierten Bundes einstimmig angenommen. Diese Erklärung löste landesweit eine heftige und kontroverse Diskussion aus. Kernpunkte waren: Das "Nein ohne jedes Ja" zu Massenvernichtungswaffen und die Erkenntnis, die Friedensfrage sei eine Bekenntnisfrage, mit der der "status confessionis" (die Notwendigkeit, von neuem ein Bekenntnis zu formulieren) gegeben sei, "weil es in der Stellung zu den Massenvernichtungsmitteln um das Bekennen oder Verleugnen des Evangeliums geht".
Bekennen in der Friedensfrage
I. Die Friedensfrage ist eine Bekenntnisfrage
II. Atomare Waffen – bis heute
III. Atomare Waffen damals (1982)
IV. Die Diskussion um die Atomwaffen in der EKD und in der Ökumene
V. Der Text der Reformierten Erklärung in ihren Thesen
VI. Bekennen in der Friedensfrage
VII. „Status confessionis“
VIII. Ist die Reformierte Friedenserklärung noch aktuell?
I. Die Friedensfrage ist eine Bekenntnisfrage
Das Moderamen (die Leitung) des Reformierten Bundes hat im Sommer 1982 die Erklärung „Das Bekenntnis zu Jesus Christus und die Friedensverantwortung der Kirche" abgegeben. Es hat darin den Versuch unternommen, den politischen Auftrag der christlichen Gemeinde wahrzunehmen und ihn in der Friedensfrage — insbesondere hinsichtlich der Stellung des Christen zu den Atomwaffen — zu konkretisieren. Der wichtigste Satz steht in der These I, wo es heißt:
„Die Friedensfrage ist eine Bekenntnisfrage. Durch sie ist für uns der status confessionis gegeben, weil es in der Stellung zu den Massenvernichtungsmitteln um das Bekennen oder Verleugnen des Evangeliums geht."
II. Atomare Waffen – bis heute
Was sind und wo waren und stehen bis heute in Deutschland atomare Waffen?
Atomare Waffen (Atom-, Wasserstoff-, Neutronenbomben) wurden seit ihrem erstmaligen Gebrauch im August 1945 gegen Hiroshima und Nagasaki (115000 bis 275000 Tote) nicht mehr eingesetzt. Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen von 1968 verbietet den Nichtkernwaffenstaaten die Nuklearrüstung und unterwirft sie einem Kontrollsystem. Dafür garantiert er allen Unterzeichnern Hilfe bei der „zivilen Nutzung“ der Kernenergie und verpflichtet die Atommächte (USA, UdSSR, England, Frankreich, China) auf Abrüstungsbemühungen.
Die Rüstungskontrollabkommen der beiden Supermächte führten Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts in Europa zur Vernichtung ganzer Kategorien von strategischen Atomwaffen. Seither ist die nukleare Bedrohung aber nicht verschwunden, sondern hat neue Formen angenommen – etwa durch Erneuerungen und Modernisierung der Waffen, durch schlecht geschützte Lagerung waffentauglichen Urans, mögliche Nuklearisierung des Terrorismus, neue Kernwaffenaspiranten – z. b. Iran oder Indien oder Israel – oder durch Neustationierungen – etwa an der Ostgrenze der EU / NATO und an der Westgrenze Russlands.
In Deutschland hat es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer Atomwaffen gegeben. Sie waren in der DDR und der BRD gegeneinander ausgerichtet. Nach der friedlichen Revolution hatten viele gehofft, die Zeit der atomaren Waffen sei in Deutschland vorbei. Nur die Nuklearwaffen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR [!] wurden abgerüstet. Auf dem Gebiet der BRD blieben sie. In „Büchel“. Büchel ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz. Büchel hat einen deutschen Fliegerhorst. Die Atomwaffen stehen unter amerikanischem Kommando. Die deutschen Bomber aber können diese Waffen jederzeit tragen und zum Einsatz bringen.
Nun bestätigen Rüstungsexperten, dass die neuen amerikanischen, taktischen Nuklearwaffen vom Typ B61-12 wesentlich zielgenauer sind als die bisherigen Atombomben. Im Kriegsfall sollen deutsche Tornado-Piloten im Rahmen der NATO-Strategie der "Nuklearen Teilhabe" Angriffe mit den US-Bomben fliegen. Mit den neuen Bomben verwischen die Grenzen einmal mehr zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen. „Uns beunruhigt, dass Staaten, die eigentlich keine Atomwaffen besitzen, den Einsatz dieser Waffen üben - und zwar im Rahmen der NATO-Praxis der Nuklearen Teilhabe“, erklärte jüngst die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa: „Das ist eine Verletzung der Artikel 1 und 2 des Vertrages über die Nichtverbreitung von Atomwaffen.“
Der Bundestag hat im März 2010 mit breiter Mehrheit beschlossen, die Bundesregierung solle sich „gegenüber den amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einsetzen.“ Auch im Koalitionsvertrag von Union und FDP hatte die Bundesregierung 2009 den Abzug der Atomwaffen aus Büchel zugesagt. Bemerkenswerterweise war es die FDP und der damalige Außenminister Westerwelle, die in dieser Sache hartnäckig waren und blieben. Doch statt der Abrüstung erfolgte nun die Stationierung von rund 20 neuen Nuklearwaffen, die zusammen die Sprengkraft von 80 Hiroshima-Bomben haben. Jüngst hat die Fraktion der „Linken“ einen Antrag im Bundestag eingebracht, in dem u. a. die Forderung an die Bundesregierung steht, „eine neue Initiative zur weltweiten Beseitigung von Atomwaffen in Umsetzung des Atomwaffensperrvertrages auf den Weg zu bringen“. Dieser Antrag fand (natürlich) keine Mehrheit.
Die Bundesregierung wird vielmehr in den kommenden Jahren rund 112 Millionen Euro in den Bundeswehrstandort Büchel investieren. Mit diesem Geld soll die Landebahn des Flugplatzes mit einem modernen Instrumentenanflugsystem ausgestattet werden. Weitere europäische Standorte amerikanischer Atomwaffen wie die Luftwaffenbasen in Incirlik in der Türkei und Aviano in Italien werden zugleich modernisiert – mit Nuklearbomben vom Typ B 61-12.
Folglich: Die derzeitige Situation der Lagerung und der Einsatzmöglichkeiten von Atombomben hat sich gegenüber der Situation 1982 nicht wesentlich gebessert.
III. Atomare Waffen damals (1982)
Wie aber gestaltete sich im Horizont der dargelegten die militärisch-politische Situation vor 33 Jahren im Horizont des sog. „Nachrüstungsbeschlusses“. Nur in diesen Zusammenhängen kann die Reformierte Friedenserklärung verstanden und gewertet werden. Ich lege sie dar in fünf kurzen Abschnitten:
1. Der NATO-Beschluss vom Dezember 1979 „108 Pershing-II-Raketen und 464 Marschflugkörper (Cruise missiles) in Westeuropa zu stationieren, bedeutete damals eine grundlegende Veränderung des militärischen Gleichgewichts zwischen Ost und West. Mit jenen Raketen kann und konnte die UDSSR in Minutenschnelle vernichtend getroffen werden, ohne dass der Angriff von amerikanischem Boden ausginge“. Man erinnere sich: Um eine solche Situation für sich selber zu verhindern, haben die USA und die UdSSR 1962 die Welt an den äußersten Rand des Atomkriegs geführt, als nämlich die Sowjets (als Antwort auf das amerikanischen Mittelstreckenpotential in Europa) ihrerseits Mittelstreckenraketen in Reichweite der USA auf Kuba stationieren wollten.
Nur (gleichsam in letzter Minute) konnte die direkte, verheerende, atomare Auseinandersetzung zwischen den beiden Supermächten verhindert werden. Seitdem galt die Absprache zwischen beiden Mächten, wonach weder die USA noch die UDSSR außerhalb ihres Landes (im Lager ihrer jeweiligen Verbündeten) Raketen lagern dürfen, die das Territorium des anderen erreichen. Diese Absprache hat das Gleichgewicht des Schreckens begründet. Die sog. Nachrüstungs-Pläne brachen die Absprache und veränderten das militärische Gleichgewicht dramatisch.
2. Mit dem Export jener Raketen nach Europa wollten sich die USA erklärtermaßen dem Risiko entziehen, Ziel eines sowjetischen Vergeltungsschlages zu werden. Die politisch und militärisch Verantwortlichen in Ost und West sprachen es offen aus. Sie wollten die Europäisierung des Atomkrieges und sie kalkulierten dabei von vornherein die Vernichtung Europas ein.
3. „Victory is possible“ hieß das Fazit einer strategischen Studie in den USA [1981]: Der Sieg ist möglich – auch im atomaren Krieg. Jahrelang beruhte die Abschreckungstheorie auf dem lapidaren Satz: „Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter.“ Jetzt sollten in Westeuropa Waffen stationiert werden, mit denen die Devise durchführbar wird: „Nur wer zuerst schießt hat die Chance zu gewinnen“. Genau dazu sollten Cruise missiles und Pershing-II dienen: nämlich so tief und so schnell zu fliegen, dass sie von den sowjetischen Warnsystemen nicht mehr erfasst werden könnten, bzw. so rasch und punktgenau ihr Ziel zu erreichen, dass sie z.B. die unterirdisch verbunkerten Langstreckenraketen der UDSSR – sie allein vermochten das Gebiet der USA zu erreichen – im Überraschungsangriff zu vernichten vermögen. Die neuen Mittelstreckenraketen verbreiteten mithin die Suggestion, ein blitzartiger Angriffskrieg gegen die Sowjetunion sei kalkulierbar im Risiko und mit einem Schlage zu gewinnen – zwar um den Preis Europas, aber zu Gunsten der USA.
4. Nun hatte die UDSSR die Waffe SS-20 stationiert und drohte die Vermehrung dieser Waffe an. Diese Lagerung und diese Drohung waren ein verheerender und unverantwortlicher Aufrüstungsschritt der östlichen Supermacht. Die SS-20 Waffe war dann für die NATO die offizielle Begründung für die sog. „Nachrüstung“. Ob es tatsächlich eine eurostrategische Lücke auf der NATO-Seite gab, war umstritten. Den SS-20 als Weiterentwicklung der veralteten Raketensysteme standen schon damals (vor der Nachrüstung) ein gewaltiges eurostrategisches Potential der NATO gegenüber: Atomunterseebote (Polaris/Poseidon) mit Mittelstreckenraketen, Jagd- und Mittelstreckenbombern unterschiedlichster Typen, in der Türkei stationierte Mittelstreckenraketen und die US- Flugzeugträger mit 72 Bombern. Mit diesen Waffen hätte die NATO allemal in der Lage sein können, einen möglichen sowjetischen Angriff zurückzuschlagen und zu vergelten.
5. Viel wichtiger als der Vergleich von Mengenangaben aber war die Frage, was die SS-20 der Sowjets hätte ausrichten können. Selbst wenn alle in der propagandistischen Auseinandersetzunga ihr zugeschriebenen Fähigkeiten zuträfen, eines konnte die SS-20 nicht, nämlich US-amerikanischen Boden erreichen. Dadurch war sie inkomparabel mit den Raketen, die die Amerikaner und die NATO in die Bundesrepublik bringen wollten.
IV. Die Diskussion um die Atomwaffen in der EKD und in der Ökumene
Seit es Nuklearwaffen gab, wurde in der Kirche in Deutschland und im ökumenischen Horizont über die Haltung der Christen dazu leidenschaftlich gestritten. In den fünfziger Jahren wurde die traditionell positive Einstellung des deutschen Protestantismus zum Militär einem verstärkten innerkirchlichen Widerspruch ausgesetzt. Vor allem Helmut Gollwitzer und Gustav Heinemann – der spätere Bundespräsident –, die Lutheraner Hans Joachim Iwand und Heinrich Vogel und die Reformierten Wilhelm Niesel und Walter Kreck waren protestantische Repräsentanten, welche die überkommene Haltung entschieden in Frage stellten.
Die Synode der EKD 1958 kam allerdings nicht über die sog. »Ohnmachtsformel« hinaus: Beide Positionen seien als christlich-ethische anzuerkennen. Diese Haltung der Ev. Kirche kennzeichnete auch die Heidelberger Thesen von 1959. Da die ethische Ablehnung von Massenvernichtungsmitteln umstritten war, bildeten sich folgende Positionen heraus:
Die „Lehre vom gerechten Atomkrieg“ (Paul Ramsey) sieht im Rahmen des Abschreckungssystems auch den Einsatz von Atomwaffen als gerechtfertigt an, die sogenannten Atompazifisten (also die genannte Gruppe) halten Besitz und Einsatz für ethisch unvertretbar, und in einer Position der Interimsethik wird der Einsatz abgelehnt (EKD), der Besitz aber vorläufig gerechtfertigt, bis das Abschreckungssystem durch ein Sicherheitssystem ohne Atomwaffen abgelöst ist.
Interimsethik kennzeichnete 1982 sowohl die EKD-Denkschrift von 1981 „Frieden wahren, fördern und erneuern« als auch Johannes Pauls II. Erklärung von 1978 vor der UNO-Abrüstungskonferenz:
Unter der Bedingung wirksamer Abrüstungsbemühungen wurde nukleare Abschreckung als »gerade noch« vertretbar bezeichnet. In Hirtenbriefen der kath. Bischofskonferenzen Deutschlands und der USA im „Nachrüstungs“-Jahr 1982 / 83 wird diese Position erneuert, in den USA allerdings mit deutlicher Kritik an der neuen amerikanischen Nuklearstrategie.
Gegen diese ethische „Ausgewogenheit“ der EKD-Denkschrift wendet sich die reformierte Friedenserklärung „Das Bekenntnis zu Jesus Christus und die Friedensverantwortung der Kirche“ von 1982 mit einem uneingeschränkten Nein zur Herstellung, Lagerung und Anwendung von Massenvernichtungsmitteln jeder Art. In ähnlicher Richtung entwickelt sich die internationale kirchliche Diskussion bis hin zur klaren Ächtung aller Massenvernichtungswaffen und zur Absage an die Abschreckungskonfrontation auf der 6. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver im August 1983: „Wir glauben, dass für die Kirchen die Zeit gekommen ist, klar und eindeutig zu erklären, dass sowohl die Herstellung und die Stationierung als auch der Einsatz von Atomwaffen ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellen und dass ein solches Vorgehen aus ethischer und theologischer Sicht verurteilt werden muss.“
V. Der Text der Reformierten Erklärung in ihren Thesen
Ich möchte jetzt die Reformierte Friedenserklärung vorstellen. Es gibt eine 1. und eine 2. Auflage. Die Thesen und ihre Erläuterungen kamen im Juli 1982 in ihrer 1. Auflage auf den Büchermarkt. Der Verlag war das „Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn“. Dieser Verlag gab auch alle Texte und Denkschriften der EKD heraus – und zwar in einem bestimmten zweifarbigen Buchumschlag, so dass der flüchtige Eindruck entstehen konnte, die Erklärung des Moderamens sei (auch) eine Denkschrift der EKD. Das hat im Kirchenamt der EKD grimmigen Ärger ausgelöst. Das Gütersloher Verlagshaus bekam eine scharfe Abmahnung und die Androhung der Lösung aller Geschäftsbeziehungen zur EKD. Deswegen mussten dann die nächsten Auflagen der Friedenserklärung in einem verwandelten Umschlag erscheinen.
Da der Text der Erklärung heute selten aufzufinden ist, dokumentiere ich hier die Thesen, denen je eine Erläuterung folgt (welche hier nicht abgedruckt ist:
DAS BEKENNTNIS ZU JESUS CHRISTUS UND DIE FRIEDENSVERANTWORTUNG DER KIRCHE
Eine Erklärung des Moderamens des Reformierten Bundes (1982)
I
Jesus Christus ist unser Friede. In seinem Tod am Kreuz und in seiner Auferstehung von den Toten hat Gott die ganze gottfeindliche Welt mit sich versöhnt und alle Menschen unter den Zuspruch und Anspruch seines Friedens gestellt. Dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat seine Gemeinde in die Welt gesandt, das Wort von der Versöhnung auszurichten, seinen Frieden zu bezeugen und im Gehorsam gegen sein Wort Frieden zu halten mit allen Menschen. Sein Friede, den die Welt nicht geben, nicht sichern oder zerstören kann, befreit und verpflichtet dazu, für den Frieden unter den Menschen zu beten, zu denken und zu arbeiten.
Dieses Bekenntnis unseres Glaubens ist unvereinbar mit der Meinung, die Frage des Friedens auf Erden unter den Menschen sei eine politische Ermessensfrage und darum unabhängig von der Friedensbotschaft des Evangeliums zu entscheiden.
Angesichts der Bedrohung des Friedens durch die Massenvernichtungsmittel (A-B-C Waffen und konventionelle Massenvernichtungswaffen) haben wir als Kirche meist geschwiegen oder nicht entschieden genug den Willen des Herrn bezeugt. Jetzt, da stärker als zuvor die Möglichkeit des Atomkriegs zur Wahrscheinlichkeit wird, erkennen wir: Die Friedensfrage ist eine Bekenntnisfrage. Durch sie ist für uns der status confessionis gegeben, weil es in der Stellung zu den Massenvernichtungsmitteln um das Bekennen oder Verleugnen des Evangeliums geht.
II
In Jesus Christus hat Gott allen Menschen Frieden gewährt. In der Versöhnungstat Jesu Christi begründet er die neue Wirklichkeit: Die ganze Welt ist mit Gott versöhnt. In dieser Wirklichkeit leben wir. Ihr sollen wir durch unser ganzes Leben im Glauben und im Gehorsam entsprechen.
Dieses Bekenntnis unseres Glaubens ist unvereinbar mit aller lebensbedrohenden Feindschaft unter den Menschen und allen ideologischen Feindbildern, mit denen eine bislang ungebändigte Aufrüstung begründet wird. Feindschaft, Bereitschaft zur Vernichtung und Vergeltung, Haß und Menschenfurcht leugnen die Wirklichkeit der Versöhnung der Welt mit Gott, deren Wahrheit Gott in der Auferstehung des Gekreuzigten offenbar gemacht hat.
Im Vertrauen auf die auch unseren Feind einschließende Versöhnungstat Jesu Christi wollen wir alle Taten des Unfriedens, allen verzerrten Bildern von Menschen und Völkern und darum auch allen mit solchen Feindbildern gerechtfertigten Massenvernichtungsmitteln den Abschied geben. In Christus sind wir alle mit Gott und darum auch miteinander versöhnte Menschen, die sich nicht wie Unversöhnte meiden, bedrohen, abschrecken oder gar vernichten dürfen.
III
Gott ist der Schöpfer und Erhalter der Welt. Trotz unserer Schuld hält und erneuert er in Treue den Bund mit uns Menschen und gibt nicht preis die Werke seiner Hände.
Dieses Bekenntnis unseres Glaubens ist unvereinbar mit der Entwicklung, Bereitstellung und Anwendung von Massenvernichtungsmitteln, die den von Gott geliebten und zum Bundespartner erwählten Menschen ausrotten und die Schöpfung verwüsten können.
Im Vertrauen auf den Gott des Bundes und der Treue wollen wir uns nicht länger von solchen „Waffen“ umgeben, „schützen“ und gefährden lassen.
IV
Gott verbindet in Christus seinen Frieden mit der Verheißung und dem Gebot menschlicher Gerechtigkeit.
Dieses Bekenntnis unseres Glaubens ist unvereinbar mit der Bejahung oder auch nur Duldung eines „Sicherheitssystems“, das auf Kosten der Hungernden und Elenden der Erde und um den Preis ihres Todes erhalten wird.
Im Gehorsam gegen den Gott des Friedens und der Gerechtigkeit wollen wir uns einsetzen für einschneidende Kürzungen der Rüstungshaushalte zugunsten der Armen. Im Vertrauen auf ihn sind wir bereit zu ersten, auch einseitigen Schritten der Abrüstung, deren politische Durchsetzung wir fordern und voranbringen wollen. Solche ersten Schritte sind:
- die grundsätzliche Verpflichtung, Konflikte ohne Anwendung oder Androhung von Gewalt lösen zu wollen,
- der Verzicht auf immer neue Waffen,
- der sofortige Einhalt der Entwicklung und Stationierung neuartiger Massenvernichtungsmittel,
- die Verpflichtung, die vorhandenen Massenvernichtungsmittel in einem Krieg nicht anzuwenden und erst recht nicht als erster einzusetzen,
- die Einrichtung kernwaffenfreier Zonen,
- kalkulierte, einseitige Abrüstungsmaßnahmen,
- das Verbot und die Verhinderung der Rüstungsexporte.
V
Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der eine und einzige Herr, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Sein Gebot ist Maßstab und Grenze auch aller innerweltlichen, politischen Verantwortung der Christen.
Dieses Bekenntnis unseres Glaubens ist unvereinbar mit der Auffassung, die Lösung des Problems der notwendigen und angemessenen Machtmittel des Staates sei allein dem politischen Ermessen und der "praktischen Vernunft" vorbehalten und es könne für Christen dabei keine eindeutige Entscheidung geben, die sich von ihrem Glauben her hinreichend begründen ließe.
Im Glaubensgehorsam gegen Jesus Christus sagen wir: Auch für staatliche Machtmittel gibt es eine durch das Gebot des Herrn gesetzte Grenze, die nicht überschritten werden darf. Massenvernichtungsmittel sind keine angemessenen und notwendigen Machtmittel, mit denen ein Staat potentielle militärische Gegner abschrecken und im Kriegsfall bekämpfen darf. Es ist zwar Aufgabe des Staates, für Recht und Frieden zu sorgen und das Leben seiner Bürger zu schützen. Aber Massenvernichtungsmittel zerstören, was sie zu verteidigen vorgeben. Ihnen gilt von seiten der Christen ein aus dem Bekenntnis zu Gott dem Schöpfer, Versöhner und Erlöser gesprochenes bedingungsloses "Nein!", ein "Nein ohne jedes Ja".
VI
Jesus Christus, der für uns gekreuzigte und auferstandene Herr, ist gegenwärtig in der Kraft des Heiligen Geistes. Unter seiner Herrschaft, die sich ohne Gewalt durchsetzt, und unter seiner Leitung, die niemanden zwingt, gewinnen wir Hoffnung und Zuversicht.
Dieses Bekenntnis unseres Glaubens ist unvereinbar mit aller Hoffnungslosigkeit und Passivität angesichts der ungeheuren Bedrohung und der oft aussichtslos erscheinenden Mühe um die Bewahrung des Friedens.
Im Vertrauen auf die Herrschaft Jesu Christi und in der Kraft des Heiligen Geistes wollen wir uns nicht entmutigen lassen, für den Frieden zu beten, zu denken und zu arbeiten. Da Jesus Christus der Versöhner und Herr der ganzen Welt ist und seine Herrschaft nicht an den Grenzen der christlichen Gemeinde aufhört, arbeiten wir auch mit Menschen zusammen, die keine Christen sind. Der tröstenden Macht seines Geistes befehlen wir uns an, wenn der Weg des Friedens ins Leid und ins Kreuz führt.
VII
Gott wird die in Christus beschlossene Versöhnung mit der Wiederkunft des Herrn vollenden und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit und Frieden ohne Ende wohnen. Steht diese Vollendung des Heils auch noch aus, so wird sie doch - von Gott in der Auferstehung des Gekreuzigten verbürgt und von ihm bestimmt - kommen und mit der Auferweckung aller Toten und dem letzten Gericht anheben.
Dieses Bekenntnis unseres Glaubens ist unvereinbar mit allem aufgeregten, ziellosen Aktivismus, allem blasphemischen Spekulieren über die "Schrecken der Endzeit", allem Desinteresse an den Fragen der Friedenserhaltung und aller politischen Gleichgültigkeit hinsichtlich der Entwicklung der Welt.
In der Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn sind wir frei zu vorläufigen, auch unvollkommenen, aber tapferen und entschiedenen Schritten für den Frieden. Vor ihm als dem letzten Richter über unser Leben werden wir Rechenschaft darüber ablegen müssen, was wir mit den jeweils eigenen Gaben dazu beigetragen haben, Widerstand gegen die Bedrohung zu leisten, die atomare Katastrophe zu verhindern und seinen Frieden in Wort und Tat zu bezeugen.
VI. Bekennen in der Friedensfrage
Mit dieser Erklärung war – das war und ist der Kern der damaligen theologischen Auseinandersetzung - der „Bekenntnisfall“, der „status confessionis“ ausgerufen. Dieses „Bekennen in der Friedensfrage“ begann mit einer Ohrfeige: „Problematische ‚Ausgewogenheit‘, Zweideutigkeit und Unentschlossenheit in der Evangelischen Kirche in Deutschland haben dieses Sondervotum herausgefordert“, schrieb der Moderator des Reformierten Bundes, der Göttinger Theologieprofessor Hans-Joachim Kraus, im Vorwort der Schrift. Es war im August 1982, als die Erklärung des Moderamens des Reformierten Bundes erschien. Die unerwartete Publizität, die die kleine Schrift erhielt, war dem Sommerloch zu verdanken – und der theologischen Klarsichtigkeit des damaligen Kirchenredakteurs der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Karl-Alfred Odin.
Karl-Alfred Odin schrieb im August 1982 einen Leitartikel, mit dem er den Text in West und Ost Deutschlands überhaupt erst richtig bekannt machte und ihn als ein „ungeheuerliches Dokument“ analysierte. Odin zeigte auf, dass der Reformierte Bund aus der EKD-Einheitsfront der ethischen Noch-Legitimierung des atomaren Waffensystems ausgebrochen war und den einen Hauptsatz der Friedensdenkschrift der EKD vom Herbst 1981 scharf und klar aufkündigte – jenen Satz eines scheinbaren Kompromisses: „Die Kirche muss auch heute ... die Beteiligung am Versuch, einen Frieden in Freiheit durch Atomwaffen zu sichern ... weiterhin als eine für Christen noch mögliche Handlungsweise anerkennen.“
Hiergegen hieß es nun im Anschluss an die Erkenntnisse der Niederländisch Reformierten Kirche in der Erklärung des Moderamens: „Die Friedensfrage ist eine Bekenntnisfrage. Durch sie ist für uns der ‚status confessionis‘ (d.i. der Bekenntnisfall) gegeben, weil es in der Stellung zu den Massenvernichtungsmitteln um das Bekennen oder Verleugnen des Evangeliums geht... Den Massenvernichtungsmitteln gilt von Seiten der Christen ein aus dem Bekenntnis zu GOTT dem Schöpfer, Versöhner und Erlöser gesprochenes bedingungsloses ‚Nein!‘, ein ‚Nein ohne jedes Ja‘.“
Mit dem „Nein ohne jedes Ja“ war eine Formulierung gefunden, die zusammen mit den Halstüchern in lila Farbe und der ebenfalls aus Holland stammenden Karikatur mit dem Fußtritt gegen die A-Bombe zum einigenden Symbol der christlichen Friedensbewegung in den 80er Jahren wurde. Der Höhepunkt war 1983 der Kirchentag, der für Tausende und in allen seinen großen Veranstaltung ganz und gar bestimmt war von der lila Farbe jener Tücher und von der Losung „Nein ohne jedes Ja“ aus der Reformierten Friedenserklärung, so dass es in der Süddeutschen Zeitung vom 13. Juni heißen konnte: „Am Schluss des Gottesdienstes vom Sonntag, als ein Meer von lila Tüchern wogte, flogen auch welche auf die VIP-Tribüne-, und eines landete auf dem Schoß des Bundespräsidenten (Karl Carstens). Der hat gelacht und es dem Helmut Kohl gereicht."
Bei aller Befriedigung über diese massenhafte zustimmende Reaktion auf unsere Erklärung darf nun aber nicht übersehen und verschwiegen werden, dass mit jenem ein innerkirchlicher Streit vom Zaun gebrochen war mit Erosionen und Verwerfungen in der EKD-West, die ihresgleichen suchten. Der damalige Ratsvorsitzende der EKD, der hannoversche Bischof Prof. Dr. Lohse schreibt in seinen Memoiren über die Diskussion hinsichtlich der Reformierten Friedenserklärung in der Kirchenkonferenz als der Versammlung aller Kirchenleiter (Bischöfe, Kirchenpräsidenten, Landessuperintendenten und Juristen) am 16. September 1982:
„In der gesamten Zeit meiner Zughörigkeit zu den Organen der EKD habe ich keine andere Beratung der Kirchenkonferenz erlebt, in der mit solcher Schärfe der Kritik diskutiert wurde.“
In der Hitze dieser Gefechte gab die Vereinigte Evangelisch Lutherische Kirche (VELKD) in der Stellungnahme ihrer Kirchenleitung bekannt:
„Wir können dem Aufruf des reformierten Moderamens nicht zustimmen, politische Entscheidungen – selbst solche auf Leben und Tod – zu Bekenntnisfragen der Kirche zu erklären. Die Kirche steht und fällt mit ihrem Bekenntnis zu Jesus Christus ... Allein im Glauben an ihn entscheiden sich Heil oder Unheil der Menschen.“
Und der Rat der EKD sagte:
„Das Bekenntnis zu Jesus Christus wird missbraucht, wenn es zur Entscheidung über offene politische Wege verwendet wird.“
Viele Christen in der Bundesrepublik reagierten mit Fassungslosigkeit auf derartige Bekenntnis-Sätze angesichts einer Situation, in der sie sich aufs Äußerste bedroht sahen und die Stationierungen von neuartigen, punktgenauen Atomraketen mit allen friedlichen Mitteln zu verhindern bereit waren.
Lohse schreibt: „Eine Flut von Briefen mit Äußerungen unterschiedlichster Art gingen bei mir ein, am Telefon wurden Beschimpfungen laut, und es kam sogar zu persönlichen Drohungen. Demgegenüber ruhige Geduld zu bewahren, war nicht immer ganz einfach“.
Aus dem 33jährigen Abstand heraus ist schwer zu verstehen, wie derartig aufgebracht und zugespitzt in der Kirche des Westens gefochten werden konnte. Man muss sich dazu vergegenwärtigen, wie aufgeheizt die politische Diskussion in West und Ost um die Raketenrüstung insgesamt war. Sie war schon längst in eine – im wörtlichen Sinne – grauenvolle und ideologisch-religiös verbrämte Auseinandersetzung abgeglitten. Der Präsident der USA Ronald Reagan bezeichnete Moskau als das „Zentrum des Bösen“ und meinte, wir würden die große apokalyptische Schlacht bei Harmagedon, in der das Reich des Bösen vernichtet wird, noch erleben. Viele standen in der Furcht, dass der sog. Ost-West-Konflikt aus der Zone der politischen Machtauseinandersetzung heraustreten und zu einem militärischen Konflikt eskalieren würde, in dem der Einsatz von atomaren Waffen auch auf deutschem Boden nicht nur denkbar, sondern auch realisierbar würde. Heute wissen wir: Es ist alles in Ost und West auch genauso geplant und kalkuliert worden, wie wir es befürchtet und analysiert haben.
Ich möchte gleichsam in einer Zwischennote auf eine Begebenheit verweisen, die recht eigentlich erst durch einen Film des Senders arte am 4. August 2015 unter dem Titel „The Man Who Saved the World“ im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist. Sie betrifft den 26. September 1983, in der Nähe von Moskau. Der Oberstleutnant der Sowjetischen Luftwaffe Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow tut seinen Dienst im Serpuchov-15-Bunker. Seine Aufgabe: die Überwachung des sowjetischen Luftraums per Satellit und Computer. Plötzlich meldet sein Rechner fünf auf die Sowjetunion anfliegende Atomraketen.
Petrow gerät unter einen ganz unglaublichen Druck, denn eigentlich müsste er die Information sofort weiterleiten, damit unverzüglich die Vorbereitungen für einen raschen Gegenschlag anlaufen und der Gegenangriff mit den sowjetischen Raketen gerichtet auf Westeuropa, besonders auf die BRD. Hätte er getan, was ihm befohlen war, wäre der atomare Krieg zwischen Ost und West ausgebrochen. Wir säßen hier nicht. Aber Stanislaw J. Petrow entscheidet sich dafür, das Ganze für einen Fehlalarm zu halten und einen amerikanischen Angriff mit "nur" fünf Raketen für unwahrscheinlich anzusehen.
Er hat damit unzweifelhaft die Welt vor einem Atomkrieg aus Versehen gerettet. Es war ein Vorgang, der wie kein Anderer heute grell erhellt, wie prekär damals vor 33 Jahren die militärische Bedrohung zwischen Ost und West war: 1983, dem Jahr, in dem die sowjetische Führung überzeugt war, die NATO stünde kurz vor einem atomaren Überraschungsangriff auf die Sowjetunion. - Seit seinem eigenmächtigen Handeln galt Petrow den Militärs nicht mehr als zuverlässiger Offizier. Seine bis dahin ungebrochen verlaufene Karriere endete abrupt. Auch einzelne, unbekannt gebliebene Ehrungen im Westen konnten nicht mehr verhindern, dass er zu einem gebrochenen Mann wurde, der heute verarmt und alkoholkrank in der Nähe von Moskau lebt.
Warum ist es trotz allem so nicht gekommen, wie wir befürchteten? Ich glaube mit der Frage 26 des Heidelberger Katechismus, „dass der ewige Vater / unsers Herrn Jesus Christus, / der Himmel und Erde / samt allem, was darinnen ist, / aus nichts erschaffen / auch dieselben noch / durch seinen ewigen Rat und Vorsehung / erhält und regiert, / um seines Sohnes Christi willen / mein Gott und mein Vater ist.“
Bundeskanzler Kohl erklärt das mit seiner Standfestigkeit gegen die Friedensbewegung, wenn er vor einigen Jahren auf evangelischem Parkett zu Tutzing in Bayern konstatiert: „Dass die Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenraketen Ende 1983 richtig war, hat die Geschichte hinlänglich bewiesen.“
Gar nichts hat die Geschichte bewiesen, weil die Geschichte über den Herrn der Geschichte nichts beweisen kann. Auch das ist seit Barmen 1934 ein Satz evangelischen Bekennens. Davon würde man im Rückblick auch gegenwärtig gern hören.
Die notwendige synodale, kirchlich-theologische Arbeit um das „Bekennen in der Friedensfrage“ aber wurde damals nicht im Westen Deutschlands angegangen, sondern im Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR. Wir im Westen, die wir das „Nein ohne jedes Ja“ um den Hals und als Bestandteil unseres Glaubensbekenntnisses in Kopf und Herz trugen, schauten dankbar – und auch neidisch – in die DDR, wo theologische Kommissionen und kirchliche Synoden die Grabenkämpfe um die rechte Auslegung eines „status confessionis“ nicht mitmachten, sondern wie in Görlitz ‘87 aussprachen, was einfach dran war:
„Wir bekennen: GOTT befreit uns durch Jesus Christus aus der Knechtschaft der Angst, die eine Folge der Sünde ist. Er befreit von Abhängigkeit und Unterdrückung. Daraus folgt: kein Mensch und kein Staat darf durch Drohung mit Massenvernichtungsmitteln Angst und Abhängigkeitsverhältnisse schaffen, um sich so seinen Frieden zu erkaufen und Macht auszuüben“ (Bundessynode in Görlitz 1987).
Heute ist die Kirche dieser Bundessynode zu Görlitz ’87 Teil der EKD. Und die EKD insgesamt steht in der Freiheit und Verpflichtung dieses Beschlusses.
VII. „Status confessionis“
Das Moderamen hat in seiner Erklärung gesagt, die Friedensfrage sei heute für uns zur Bekenntnisfrage geworden, durch die wir uns in den „status confessionis" gestellt sehen. Die Verwendung der beiden lateinischen Worte „status confessionis" hat geradezu hysterische Reaktionen ausgelöst. Man hat diesen Begriff behandelt wie einen gefährlichen Sprengsatz, den das Moderamen unverantwortlicherweise an die Einheit der EKD gelegt habe; ja, es hat sogar Stimmen gegeben, die in der Benennung des status confessionis ein sicheres Indiz für die Verwandlung des Moderamens in eine Sekte glaubten finden zu können. Auch ist gesagt worden, der „Reformierte Bund“ sei ja nur ein Verein und keine Kirche, so dass niemand in der „Kirchen“ sich davon berührt fühlen müsse. Bei alledem ist der „status confessionis" mit Vorstellungen und Unterstellungen beladen worden, die keineswegs einen zureichenden Anhalt haben an den historischen Situationen, in denen dieser Begriff schon einmal in den reformatorischen Kirchen verwandt und geprägt worden ist.
[Nebenbei: Die Frage mag gestellt werden, ob es der Heilige Geist oder der altböse Feind war, der uns den „status confessionis"in die Erklärung geschrieben hat. Für den Heiligen Geist spricht die Vermutung, dass die Moderamenserklärung ohne diesen emphatischen Begriff wohl kaum zu der Intensität geführt hätte, mit der sie beachtet wurde. Für den altbösen Feind spricht, dass den Gegnern der Moderamenserklärung durch die Verwendung des „status confessionis" vielfältige Gelegenheit gegeben wurde, statt sich der Aktualität der ethischen Frage zu stellen, auszuweichen in historische und dogmatische Oberseminare.]
In der Moderamenserklärung ist der Begriff [status confessionis] aufgenommen worden in der Weise, wie ihn Dietrich Bonhoeffer im Kirchenkampf, Karl Barth und der Lutheraner Ernst Wolf zusammen mit den Kirchlichen Bruderschaften in der Auseinandersetzung der 50er Jahre verwandt und geprägt haben: als ein Begriff, der nicht weniger signalisiert als die Erkenntnis einer Situation, in der das christliche Bekenntnis in besonderer Weise herausgefordert ist und sich die Einheit der stets bekennenden Kirche in Glauben und Gehorsam neu zu bewähren hat. Das hieß damals für uns aktuell:
Wir meinten damals und sprachen es auch so aus, eine Benennung des status confessionis wie ihn die Kirche 1933 durch die anhebende politische Diskriminierung der Juden, die den Holocaust vorbereitete, aus ihrem Bekenntnis zu Jesus Christus heraus hätte Stellung beziehen und ihre Einheit in Glauben und Gehorsam hätte bewähren müssen; wie damals so seien wir heute unter politisch anderen Bedingungen durch die Bedrohung des Friedens durch die atomaren Waffen in einen vergleichbaren status confessionis versetzt. Damals wurde eine von außen auf die Kirche zukommende sog. „politische Frage" zur Bekenntnisfrage, und es waren nur wenige Christen, unter ihnen Dietrich Bonhoeffer und Martin Niemöller, die diese Frage in ihrem Gewicht erkannten.
Im Stuttgarter Schuldbekenntnis ist darum zu Recht gesagt worden: „Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.“ Die Judenfrage war 1933 eine von den meisten erst zu spät oder überhaupt nicht erkannte Bekenntnisfrage. „Es ist gewiß kein Zufall“, schrieb Niemöller damals in der „Jungen Kirche“, „sondern ein Zeichen von 'groß Macht und viel List', dass die Gemeinde Jesu so angegriffen wird, dass nur ein Teil von ihr wirklich merkt: Es geht ums Ganze!“ Das schien dem Moderamen damals in der Sache nicht anders, auch wenn die politischen Umstände ganz andere waren und das Zeugnis der Kirche von außen unbedroht erschiene und darum umso freimütiger hätte sein können:
Das Moderamen war damals der Meinung und sagte es: Die Frage des Friedens und seiner Bedrohung durch die Massenvernichtungsmittel ist zu einem Problem geworden, das den Glauben an Jesus Christus so herausfordert, dass wir ihn neu und in aktueller Zuspitzung bekennen müssen. Wir hatten triftige Gründe für die Behauptung: So wie damals die Diskriminierung der Juden den Holocaust vorbereitete, so wird heute (1982) durch die Veränderung der militärischen und politischen Strategien, durch die Verfeinerung der Waffensysteme und durch die Vorbereitung der Stationierung atomarer Erstschlagswaffen das atomare Inferno vorbereitet.
Unser Glaube an Jesus Christus werde dadurch derartig herausgefordert, dass Schweigen und Gleichgültigkeit der Verleugnung des Glaubens gleichkomme und ein Einverständnis mit dieser Entwicklung dessen faktische Verleugnung bedeuten würde. Wir sagten: Der status confessionis ist nicht erst gegeben, wenn die Bomben fallen, sondern jetzt, wo die Vorbereitungen zu ihrem Einsatz getroffen werden und es — wie die holländischen Reformierten sagen — „nach menschlicher Einsicht zu spät zu sein scheint". Aus dem Holocaust an den Juden die bitteren Lehren ziehen, so meinten wir damals, heiße heute, den atomaren Holocaust mit allen uns noch zu Gebote stehenden Möglichkeiten verhindern helfen!
Ich halte heute die damalige Parallelisierung von „Holocaust“ und Atomwaffenbedrohung für sehr problematisch und für völlig verfehlt. Die Judenvernichtung in Deutschlands Drittem Reich ist eine einzigartiges Verbrechen, das nicht als „Beispiel“ instrumentalisiert werden darf. Heute sage ich nachdrücklich, wir hätten das so nicht parallelisieren und ausdrücken dürfen.
Für das Moderamen und den durch uns repräsentierten Reformierten Bund sollte gelten: Den „status confessionis“ zu benennen, heiße nicht, die innerkirchliche Friedensdiskussion eigenmächtig zu dramatisieren. Sondern — ob wir wollen oder nicht — wir (d. h. eine Unzahl von Gemeinden, Gruppen, einzelnen Christen und unter ihnen aber auch das Moderamen) sehen die Kirche durch das Wort Gottes in den status confessionis versetzt, weil sie sich grundstürzenden Problemen gegenübersieht, „bei denen es um die Not der menschlichen Existenz in dieser Welt, um das Menschsein des Menschen und darin zugleich wieder um Anerkennung oder Verleugnung Gottes geht“, wie es der Lutheraner Ernst Wolf hinsichtlich der Bedingung für den status confessionis formuliert hat.
Mit der Feststellung des „status confessionis“ werden, so war es unsere Position, der Ernst und die Dringlichkeit unterstrichen, jetzt das Bekenntnis zu Jesus Christus auszusprechen, es angesichts der Herausforderung in seinen unabweisbaren Konsequenzen zu bedenken und zu entfalten und die Schritte des sich daraus ergebenden, letztlich von Christus selber geforderten Gehorsams nicht zu verweigern. Zu den in statu confessionis gewonnenen Einsichten und Erkenntnissen gehört auch das „Nein“ zu Lehren und Meinungen, die sich am Maßstab des Evangeliums als unhaltbar erweisen. In diesem Fall war es nach unserer Sicht die „Lehre“: „Die Kirche muß die Beteiligung an dem Versuch, durch das Dasein von Atomwaffen einen Frieden In Freiheit zu sichern, als eine heute noch mögliche christliche Handlungsweise anerkennen“ (Heidelberger These VIII). Wir sagten: In der Konsequenz des Bekenntnisses zu Jesus Christus und angesichts der Herausforderung durch die Situation ist diese Überzeugung für einen Christen unvertretbar geworden.
Wer eine solche Feststellung damals traf, bekam regelmäßig die Vorwürfe zu hören, dass er anmaßend anderen ein Gesetz auferlege, dass er unevangelisch die Gewissen binde, dass er seinen Schwestern und Brüdern in der Kirche das Christsein und den Glauben abspreche und den Frieden in der Kirche und deren Einheit mutwillig zerstöre.
Wir antworteten damals: Die in statu confessionis herausgeforderte und gefährdete Einheit der Kirche kann nicht dadurch gefunden werden, dass man die gegensätzlichen Standpunkte zugunsten einer Scheineinheit verwischt oder als gleichberechtigte, nur eben unterschiedliche Ausdrucksweisen des Christseins toleriert. Die Kirche ist nach ihrer allein tragfähigen Einheit in Glauben und Gehorsam gefragt. Ihre Einheit ist die mit der Wahrheit und der Eindeutigkeit ihres Zeugnisses verbundene Einheit, die es nicht zulässt, dass Christen in Bekenntnisfragen zu sich gegenseitig ausschließenden Ergebnissen kommen.
VIII. Ist die Reformierte Friedenserklärung noch aktuell?
Es hat vor einiger Zeit eine UNO-Konferenz in Oslo gegeben, die sich befasste mit der schlichten Frage, was ein Atomwaffeneinsatz für unmittelbare Folgen für den Menschen haben werde. Nur ein Ergebnis sei genannt: der Einsatz von etwa fünfzig Atomwaffen werde so viel Dreck in die Luft befördern, dass eine Milliarde Menschen wegen der völlig verdunkelten und eingeschränkten Sonneneinstrahlung am Hungertod sterben würde. Die präzis begründeten Ergebnisse der Konferenz, an der Vertreter von 127 Staaten und von drei zuständigen UNO-Organisationen teilgenommen haben, sind entsetzlich.
Politisch ist zu gewärtigen, dass Israel atomar bedroht wird und dass neben allen anderen derzeit geführten Kriegen ein Krieg mit einer Atommacht jederzeit in den Bereich der Anwendung atomarer Waffen kommen kann. Mächte mit Atomwaffen sind neben den Siegern des Zweiten Weltkrieges China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Würde auch nur eine dieser Mächte Atomwaffen gebrauchen – und das ist voraussehbar – und es käme nur eben zur Zerstörung von Atomkraftwerken oder nur zur Inbesitznahme atomaren Materials, würde das zu einer unvorstellbaren Katastrophe geraten, gegen die Fukushima ein Kinderspiel gewesen wäre.
Etwas später legte – gleichsam als Fortsetzungsanalyse – das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI seinen Jahresbericht vor, in dem über die derzeitigen atomaren Besitzverhältnisse berichtet wird:
Die Fähigkeit, sofort einen atomaren Krieg führen zu können, haben nach wie vor die beiden Hauptmächte USA und Russland. Sie geben vor, ihre atomaren Waffenarsenale reduziert zu haben. Der Vorgang kann verglichen werden mit zwei Alkoholkranken, die einen riesigen Weinkeller im Haus haben und ihren etwas geminderten Vorrat an Alkoholika als Weg zur Abstinenz ausgeben.
Auf dem Gebiet der Bunderepublik, der Niederlande, Belgiens, Italiens und der Türkei, lagern nach wie vor amerikanische Atomwaffen, deren Anzahl der Geheimhaltung unterliegt. SIPRI rechnet vor, dass es derzeit mindestens zweitausend, sogleich einsatzbereite Atomsprengköpfe gibt. Der Bestand umfasst ein Vielfaches.
Und wie steht es in dieser Situation um die kirchliche Positionierung?
Der Reformierte Bund hat unlängst in einer Erklärung des jetzigen Moderamens zum 70. Jahrestag der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 2015 Folgendes gesagt:
»Am 6. und 9. August 1945 wurden über Hiroshima und Nagasaki Atombomben abgeworfen – sie haben Tod und bis heute währendes Leid über hunderttausende Menschen gebracht. Die Schreckenserfahrungen haben die Menschheit nicht zur Einsicht gebracht. Trotz der militärischen Entspannungsphase seit den achtziger Jahren und damit verbundener Abrüstungsinitiativen lagern auch heute – 70 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki – in Deutschland über 100 Atomwaffen mit deutlich größerem Vernichtungspotential.
Der Konflikt um die Ukraine zeigt, wie fragil der Friede auch in Europa ist; das Drohen mit dem Einsatz von Massenvernichtungsmitteln scheint wieder möglich zu sein.
1982 hat sich der Reformierte Bund e.V. eindeutig gegen den Einsatz und die Bereitstellung von Massenvernichtungsmitteln ausgesprochen: »Christen können unter keinen Umständen damit einverstanden sein, daß solche Mittel eingesetzt werden. Und sie können ebensowenig ihre Zustimmung dazu geben, daß solche Mittel als angeblich ›politische Waffen‹ hergestellt und bereitgehalten werden, um mit ihnen zu drohen, ›abzuschrecken‹ und sie ins politische Kalkül einzubeziehen.« (Das Bekenntnis zu Jesus Christus und die Friedensverantwortung der Kirche, 1982, 20). Diese Erkenntnis [!!] hat auch 2015 nichts an ihrer Aktualität eingebüßt.
»Wir fordern deshalb die Bundesregierung auf, sich für den vollständigen Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland stark zu machen. Wir fordern die Bundesregierung ebenfalls auf, sich Initiativen anzuschließen, die in Konsequenz des Nichtverbreitungsvertrages auf die vollständige Abrüstung aller Atomwaffen weltweit zielen.«
Diese Erklärung hat, soweit ich es sehen konnte, weder im epd noch in idea eine Meldung bekommen. Zu finden ist sie nur bei „reformiert-info“ im Internet. Daraus ist zu schließen, dass die Friedenserklärung des Moderamen von 1982 wohl ihre Zeit gehabt hat. Sie regt niemanden mehr auf. Und sie regt zu nichts mehr an und auf. Der „status confessionis“ ist erloschen, vorbei. Nicht einmal das Moderamen erinnert an ihn.
Und so scheint es wohl nötig zu sein, eine andere Sprache zu sprechen, eine andere Theologie zu treiben als die, die vor 33 Jahren etwas mitzuteilen hatte und aufregen konnte. Vermutlich ist darum jene Erklärung von 1982 wohl ein wichtiges Dokument der deutschen Kirchen- und Theologiegeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber eben ein Dokument von gestern.
Ich nenne in der kürzesten Fassung, was meines Erachtens die Kirche und auch der Reformierte Bund heute sagen sollte:
Der Mensch sieht den Teufel nicht mehr. Er hat ihn geschluckt.
Kriege werden um ihrer selbst willen geführt. (1942) - Elias Canetti, Das Buch gegen den Tod, München 2014
Bellizismus und Pazifismus sind mimetische Doppelgänger: Sie ergänzen einander sehr gut. Kein Land ist gewillt,
die Wahrheit über seine Gewalt zu hören. Es wird immer versuchen, sie um des Friedens willen zu verbergen. Jesus hat sich den Menschen genähert, indem er ihre Gewalt kopflos machte und sie bloßstellte. Der Heilige Geist setzt sein Werk in der Zeit fort. Gerade er lässt uns begreifen, dass das historische Christentum gescheitert ist und die apokalyptischen Texte von nun an stärker zu uns sprechen als je zuvor. Die Propheten und Psalmen haben diese fundamentale Interpretation der Ankunft Gottes vorbereitet, der eins ist mit dem Kreuz. Hier ist das Opfer göttlich, bevor es sakralisiert wird. Das Göttliche geht dem Sakralen voraus. Es stellt die Rechte Gottes wieder her. Dieser Gott, dieser kommende Andere ... bringt das ganze System zum Einsturz. - Rene Girard, Im Angesicht der Apokalypse.
Ein großes Zeichen im Himmel: ein Weib. Und der Drache trat vor das Weib, das gebären sollte, auf dass, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Stuhl. Und das Weib entfloh in die Wüste. - Offenbarung des Johannes 12, 1,4-6
Prof. Dr. Rolf Wischnath, Bielefeld 2016
Das Moderamen des Reformierten Bundes die Bundesregierung auf, »sich für den vollständigen Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland stark zu machen«.